„Man kann schwere Verläufe verhindern“

Stabile Seitenlage oder Mund-zu-Mund-Beatmung kennen die meisten. Doch wie reagiert man auf eine psychische Krise? Sozialarbeiterin Katharina Daly von Promente lehrt das im Erste Hilfe Kurs für die Seele.
1. Wie erkenne ich eine psychische Krise?
Katharina Daly: Wenn mir bei einer Person in meinem Umfeld Veränderungen im Verhalten auffallen und ich mir deswegen beginne, Sorgen zu machen. Es kann sein, dass die Person Ängste hat in Situationen, die sonst unproblematisch waren, verzweifelt ist, sich immer mehr zurückzieht oder unnachvollziehbare Gedanken äußert. Aber auch wenn jemand, den man als aktiven Menschen kennt, plötzlich antriebslos ist oder stark gereizt und aufbrausend agiert oder davon spricht, nicht mehr leben zu wollen, sind das Hinweise für eine psychische Krise.
2. Wie unterscheide ich Findungsphasen in der Pubertät von Krisen?
Daly: Die Pubertät ist eine herausfordernde Zeit, das jugendliche Gehirn befindet sich in einer Umbauphase und ist besonders anfällig für Irritationen. Man ist als Angehöriger oder Lehrperson schon darauf eingestellt, dass es anstrengend sein kann. Wenn bei dem jungen Menschen der Leidensdruck sehr hoch ist und sich seine Wahrnehmung, die Gefühle und das Handeln so stark verändert haben, dass ich es nicht mehr als „normal“ einschätze und mir Sorgen mache, ist es wichtig eine Beratung auf zu suchen. Je früher die Auffälligkeiten ernst genommen werden, desto höher ist die Chance, eine psychische Erkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dies geschieht immer durch einen Facharzt, denn es kann auch sein, dass sich Auffälligkeiten wieder auswachsen. Es ist besser, einmal zu viel in eine Beratung zu gehen, als Hemmungen zu haben. Jeder wird mit seinen Sorgen ernst genommen. Ich bin mir sicher, dass jeder Berater sagen wird: „Gut dass Sie aufmerksam waren und so frühzeitig zu uns in Beratung gekommen sind“.
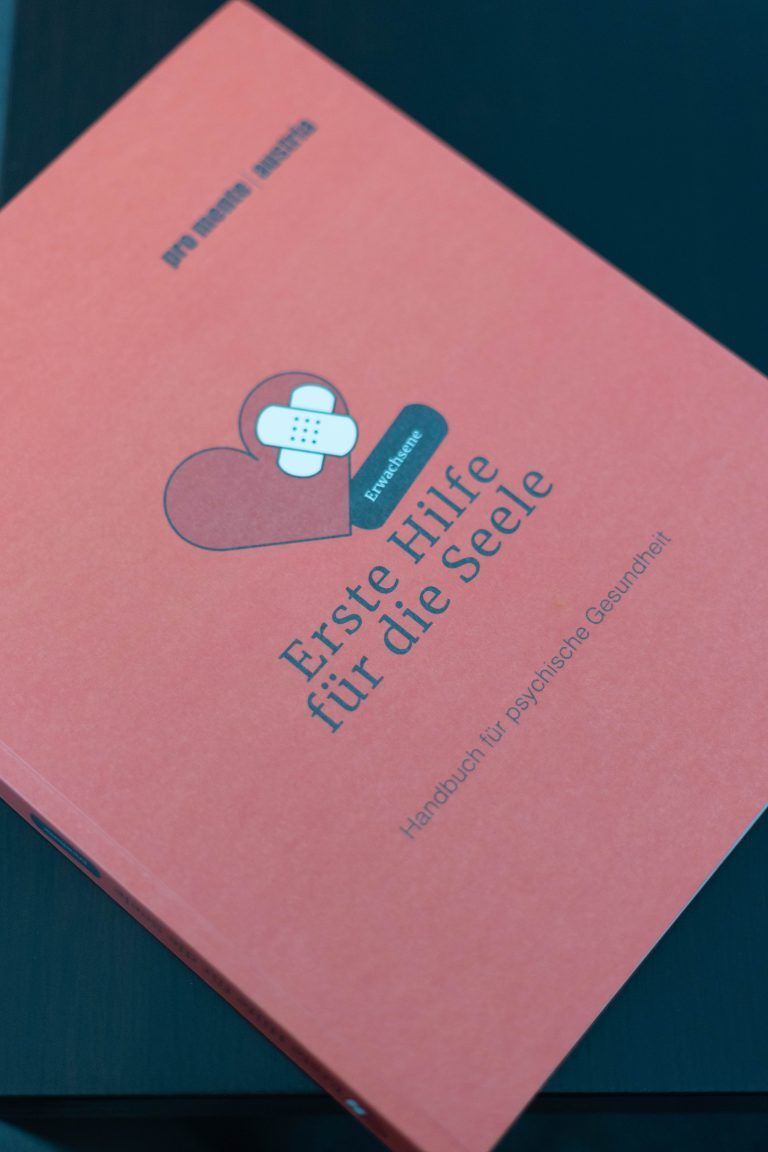
3. Was kann durch frühes Handeln verhindert werden?
Daly: Durch eine frühzeitige Betreuungssituation kann verhindert werden, dass psychische Erkrankungen schwere Verläufe haben oder sich chronifizieren. Das geschieht durch einen Facharzt, der eine Diagnose stellt und die nötige medikamentöse Behandlung verschreibt. Es sind Termine bei Psychotherapeuten wichtig, um belastende Situationen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, belastende Faktoren im Umfeld zu erkennen und um einen Umgang mit der Erkrankung zu erlernen. Die soziale Situation kann es erforderlich machen, dass man Unterstützung bekommt, wie bei einer schwierigen Wohnsituation, familiären Problemen, finanziellen Belastungen oder Problemen am Arbeitsplatz oder in der Schule.
4. Wie weiß ich, dass professionelle Hilfe notwendig ist und ich als Freund nicht ausreiche?
Daly: Wenn z.B. eine Freundin einen schweren Verlust erleidet, kann ich ihr mit meiner Anwesenheit und Gesprächen eine Hilfe und Unterstützung sein. Wenn ich merke, dass das Gefühl der Trauer und der Verzweiflung mit der Zeit nicht abnimmt und das übersteigt, was ich als „normal“ empfinde, ist es wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann ich meiner Freundin sagen, ihr helfen, eine Beratungsstelle aufzusuchen, sie eventuell dorthin begleiten. Es kann sein, dass sie das Angebot ablehnt und die Notwendigkeit einer professionellen Hilfe nicht sieht. Dann kann ich erst selbst in Beratung gehen, um die Situation zu reflektieren und über meine Besorgnis zu sprechen.
5. Welches Handwerkzeug gibt es bei der Ersten Hilfe für die Seele?
Daly: Es gibt fünf Schritte, die wir im „Erste Hilfe für die Seele“-Kurs „ROGER“ nennen. Die Buchstaben stehen für Schritte. Diese müssen nicht nach dieser Reihenfolge stattfinden. Das „R“ steht für „Reagieren und Ansprechen“. Etwas tun ist immer besser als nichts tun. Wenn ich Angst habe, etwas falsch zu machen, darf mir bewusst sein, dass ich ein Laie bin und ich keine Diagnose stellen muss. Beim „O“ geht es um das „offene und unvoreingenommene Zuhören“. Viele Menschen sind froh, wenn sie reden können und merken, dass da jemand ist, der sich ihr Problem anhört und stark genug ist, das auszuhalten. Das kann befreiend wirken. Ich muss keine Lösung aus dem Ärmel schütteln. Es ist viel damit getan, dass ich zuhöre. Im Kurs lernen Teilnehmer, dass es professionelle Hilfen gibt und wo sie zu finden sind. Das „G“ steht für „gib Unterstützung und Information“ und „E“ steht für „Ermutigung zu professioneller Hilfe“. Wenn ich merke, mein Gesprächspartner befindet sich in einer akuten Krise und ich kann nichts mehr bewirken, dann ist es wichtig zu schauen, wieviel ich aushalten kann, ob ich an meine Grenzen komme. Spätestens dann sollte professionelle Hilfe eingeschalten werden. Das „R“ steht für „reaktiviere Ressourcen“ und bedeutet, dass man gemeinsam überlegt, was dem Betroffenen in der Vergangenheit in Situationen geholfen hat, in denen es ihm nicht gut ging. Das können Gespräche mit Freunden oder Familie sein, Bewegung in der Natur, Entspannung, kulturelle Beteiligung oder Musizieren.

6. Kann ich etwas falsch machen?
Daly: Aussagen wie „Das wird schon wieder“, „stell dich nicht so an“, „das ist nicht so schlimm“ sollte man vermeiden. Diese können fallen, wenn Menschen keine Vorstellung davon haben, wie schwer psychische Erkrankungen die Betroffenen im Alltag beeinträchtigen. Es wird unterschätzt, wie sehr psychische Erkrankungen Betroffene beeinträchtigen zu arbeiten, für sich selbst zu sorgen und Beziehungen zu pflegen. Vergleicht man die Beinträchtigungen durch eine psychische Erkrankung mit körperlichen Erkrankungen, so kann man eine schwere Depression mit einem metastastierenden Brustkrebs gleichsetzen. Stattdessen sind Ich-Botschaften gut, wie etwa „Ich mache mir Sorgen um dich“, oder „Ich hab seit einigen Wochen beobachtet, dass du am Morgen sehr müde und gestresst wirkst. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann?“. Der Zeitpunkt, an dem ich ein Gespräch aufnehme, ist wichtig. Es sollte ein ruhiger, geschützter Rahmen ohne Zeitdruck sein. Psychische Erkrankungen sind ein großes Tabu, über das man meist nicht spricht. Das Thematisieren würde viel bewirken können. Oft gibt es Leidenswege von bis zu zehn Jahren und mehr, bevor jemand Hilfe aufsucht. Je mehr über psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft gesprochen wird, umso schneller werden sie entstigmatisiert und desto kleiner wird die Hemmschwelle, Hilfe aufzusuchen.
7. Wie kann ich meine psychische Gesundheit fördern?
Daly: Da gibt es mehrere Schritte, die einfach und banal klingen und bei denen uns nicht bewusst ist, wie wichtig sie sind. Wir sind den Erkrankungen nicht ausgeliefert, sondern können viel zur psychischen Gesundheit beitragen. Die Ressourcen, die einem gut tun, können für jeden andere sein. Für die einen ist es Yoga, für andere sind es Meditation oder Spaziergänge. Auch das Annehmen von sich selbst kann ein wichtiger Schritt sein. Das kann dadurch geschehen, dass man sich im Spiegel anschaut und Körperteile aufzählt, die man an sich besonders mag. Auch das abendliche Aufschreiben von Erfolgen an diesem Tag kann die psychische Gesundheit fördern. Darüber reden oder Tagebuch schreiben können Ressourcen sein, etwas zu verarbeiten. Triff dich regelmäßig mit lieben Menschen. Und wenn sie dich fragen, wie es dir geht, sag nicht immer „gut“, sondern auch dass es dir nicht gut geht. Das aktive Beteiligen im Alltag und Neues Lernen kann positiv wirken. Das muss nicht gleich ein Computerkurs sein, sondern kann auch bedeuten, dass man einen handyaffinen Neffen zu Rate zieht. Wichtig für Entspannung und Schlaf ist, dass man vor dem Schlafen gehen das stimulierende blaue Licht von Computer und Handy meidet.