Die Blockade in uns
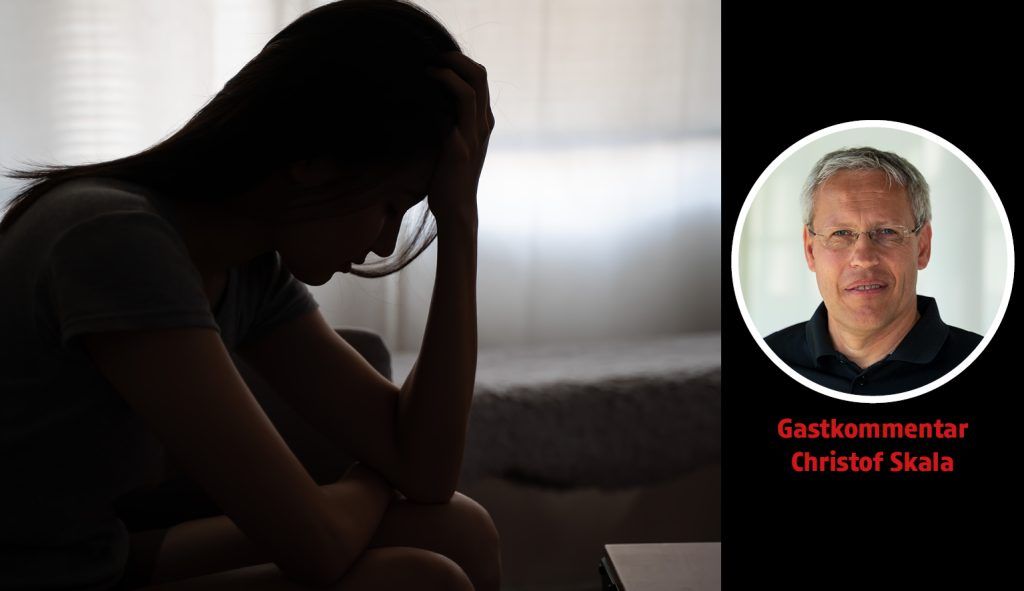
Warum Reformen oft scheitern und wie sie gelingen können.
Von Christof Skala
neue-redaktion@neue.at
Wohin man schaut, Krisen, Missstände und Nöte sind derzeit allgegenwärtig. Wir betreiben Ursachenforschung, erkennen Fehlentwicklungen, können Verantwortliche ausmachen und bringen Vorschläge für dringende Reformen. Über erforderliche Systemanpassungen können Gesellschaften jahre- oder jahrzehntelange diskutieren, ohne dass sich Grundlegendes ändert. So bleiben tiefgreifende Reformen beispielsweise im Staats-, Bildungs- oder Gesundheitswesen bislang aus.
Wieso der Mensch so viel Widerstand gegen notwendige Änderungen im System aufbringt, lässt sich in erster Linie neurobiologisch erklären. Unser Gehirn mit nur zwei Prozent der Körpermasse benötigt etwa 20 bis 25 Prozent der gesamten Körperenergie. Evolutionsbedingt ist es daher auf Energiesparen programmiert. Am wenigsten Energie verbraucht das Hirn im Zustand der Kohärenz. Daher streben wir unbewusst nach Stimmigkeit, Stabilität und Sicherheit. Veränderungen bergen fast immer Risiken – und stetiges Problemlösen kostet Energie.
Diese Neigung zum Verharren lässt sich auch auf die Gesellschaft umlegen. Ein kollektives Kohärenzstreben verhindert so lange größere Veränderungen, bis der Leidensdruck überhandnimmt. Profiteure bestehender Strukturen mit Machterhaltungsinteressen arbeiten strategisch zudem oft am Aufrechterhalten ineffizienter Systeme.
Die Verankerung großer Reformen gelingt am ehesten, wenn das Kohärenzbedürfnis beim Einzelnen und im Kollektiv durch gezielte Maßnahmen bewusst berücksichtigt wird. Systemeingriffe müssen emotional als nicht existenzbedrohlich, als mitgestaltbar und sinnstiftend erlebbar gemacht werden. Eine erfolgreiche Gesamtstrategie beginnt mit einem gemeinsamen Zielbild, schnürt ein Gesamtreformpaket (statt losgelöster Einzelmaßnahmen), stellt menschliche und gesellschaftliche Werte vor technokratische Zahlen, zeigt den größeren Sinnzusammenhang und Szenarien auf (was passiert, wenn wir nichts tun). Sie betont die Dringlichkeit und bietet Sicherheitsnetze. Eine Reformagenda durch eine breit aufgestellte Taskforce mit einem Umsetzungsmandat erzeugt die erforderliche Verbindlichkeit. Und die Kommunikation durch anerkannte Persönlichkeiten schafft das notwendige Vertrauen. So kann Wandel gelingen.
