Ein Bauernsohn als Mörder und NS-Opfer
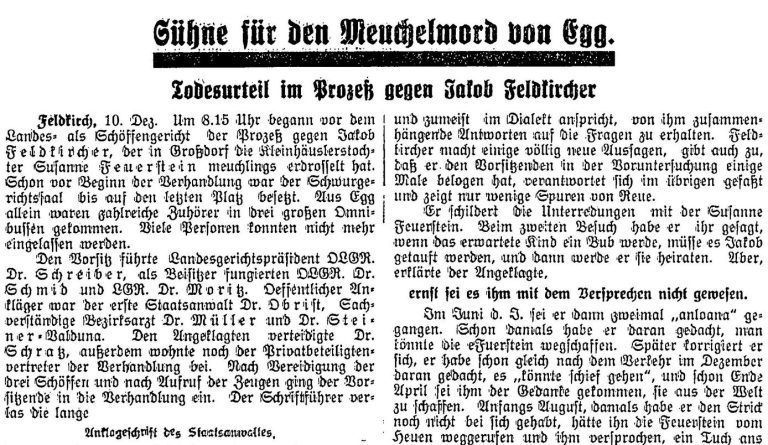
In einer Tenne wird 1936 eine erhängte Frau gefunden. Vieles deutet auf einen Suizid hin, doch die Ermittler finden den wahren Täter, der später selbst zum Opfer wird.
Der Kleinbauer Josef Feuerstein besucht am Sonntag, den 9. August 1936 wie üblich frühmorgens die Kirche in Egg und bleibt danach im Dorf. Abends geht er noch ins Gasthaus. Erst um Mitternacht kehrt der Häusler auf seinen kleinen Hof in Hochegg in Großdorf zurück, wo er mit seiner Tochter Susanne lebt. Sie ist hochschwanger, aber trotz später Stunde nicht in ihrem Zimmer. Dafür ist entgegen der Gewohnheit die angrenzende Tenne verschlossen. Als der Vater seine Tochter dort sucht, macht er eine schreckliche Entdeckung.
Anscheinender Suizid
Susanne Feuerstein hängt tot von einer Leiter, die quer über zwei Balken liegt. Als der Vater sein Kind findet, erleidet er einen schweren Schock und stürzt bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kommt, verständigt er seinen in Großdorf wohnenden Sohn Kaspar. Dieser ruft sofort die Gendarmerie.
Zunächst sieht alles nach einem Suizid aus. Susanne Feuerstein erwartete ein uneheliches Kind – zur damaligen Zeit nicht nur im Bregenzerwald ein schweres gesellschaftliches Manko. Spuren, die auf ein Fremdeinwirken hindeuten, werden zunächst keine gefunden. Für die ermittelnden Beamten könnte hier alles mit einem Aktenvermerk enden, doch sie führen weitere Erhebungen durch.
Denn der Vater der Toten besteht darauf, dass seine Tochter keine Anzeichen für einen bevorstehenden Suizid gezeigt habe. Sie sei hingegen gut gelaunt gewesen und habe erklärt, der Vater des Kindes werde für alle Kosten aufkommen. Den Namen des Mannes kennt Josef Feuerstein zwar nicht, doch er hat einer Vermutung, die sich bei der Einvernahme seines Sohnes bestätigt. Ihrem Bruder hat sich Susanne anvertraut: Der Vater ihres ungeborenen Kindes war der 35-jährige Nachbarssohn Jakob Feldkircher.
Konfrontation mit dem Bruder
Als die Gendarmerie diesen befragt, streitet er alles ab. Er habe keine Affäre mit der Toten gehabt und sei auch nicht der Vater ihres Kindes. Dass er sein Verhältnis mit Susanne Feuerstein so vehement leugnet, bestärkt den Verdacht der Ermittler. Sie untersuchen sein Alibi. Tatsächlich war Feldkircher am Tattag mit seinem Vater und seinem Neffen auf der Vorsäß Bachhub beim Heumachen, absentierte sich aber nach einiger Zeit. Feldkircher behauptet, er habe einen „Burschen mit weißem Rock und roter Hose“ um das Haus der Feuersteins schleichen sehen.
Doch seine Versuche, sich herauszureden, machen für den Bauernsohn alles nur noch schlimmer. Um ihn emotional unter Druck zu setzen, entschließen sich die Gendarmen zur Konfrontation des Verdächtigen mit dem Bruder des Opfers. Als Kaspar Feuerstein ihm aufs Gesicht zusagt, er wisse, dass dieser der Vater des ungeborenen Kindes gewesen sei, bricht Feldkircher ein. Er gibt zunächst die Vaterschaft und im Laufe des Verhörs auch den Mord zu. Er habe das Opfer zunächst abgelenkt, und dann mit einem Heustrick von hinten erdrosselt. Anschließend habe er die Tote in der Tenne aufgeknüpft, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Zur Täuschung verwendete er eine als „Weiberknoten“ bekannte Schlaufe.
Angst vor dem Vater
Jakob Feldkircher wird an Ort und Stelle in Haft genommen. Seine herbeieilenden Eltern wollen noch schreiend dazwischengehen. Ihr Sohn sei Opfer eines Justizirrtums, behaupten sie. Doch Jakob Feldkircher gibt auch ihnen gegenüber zu, Susanne Feuerstein ermordet zu haben.
Als Motiv nennt er die Angst vor seinem Vater. Als Susanne Feuerstein ihm erklärt, die Geburt werde 200 Schilling kosten und sie erwarte sich weiters 25 Schilling an monatlichem Unterhalt, gerät er in Panik. Jakob Feldkircher kann sich die geforderten Summen nicht leisten und hat Angst, sein gleichnamiger Vater werde ihn vom Hof jagen. Eine Tochter musste den Hof bereits wegen einer unliebsamen Heirat verlassen.
Die Ermittler der Bundesgendarmerie beschäftigt vor allem eine Frage: Ist der Täter mit dem Strick zum Haus der Feuersteins gekommen oder lag er in der Tenne? Feldkircher behauptet, die Tatwaffe vor Ort gefunden zu haben, doch weitere Nachforschungen ergeben, dass er vom Hof seiner Eltern stammte. Daraufhin gibt Feldkircher auch das zu, erklärt aber, er habe ihn nur dabei gehabt um Heu zusammenzubinden. Doch durch die vorherigen Lügen ist seine Glaubwürdigkeit bereitserschüttert. Die Ermittler gehen von einer geplanten Tat aus.
Vor Gericht
Als Jakob Feldkircher sich am 10. Dezember 1936 vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten muss, lautet die Anklage nach dem damals geltenden Strafgesetz auf Meuchelmord. Auch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er in heimtückischer Absicht mit dem Strick zum Tatort kam, um Susanne Feuerstein zu ermorden.
Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Landesgerichtspräsident Martin Schreiber hat Schwierigkeiten mit der Einvernahme des Wälders: „Seine unbeholfene Sprache bringt manche Ausdrücke, die auch im Dialekt nur mehr selten zu hören sind. Nur allmählich gelingt es dem Verhandlungsleiter, der Feldkircher milde auffordert, nun zu erzählen, wie alles kam, den Angeklagten mit dem Duwort und zumeist im Dialekt anspricht, von ihm zusammenhängende Antworten auf die Fragen zu erhalten“, berichtet die Landeszeitung vom Prozess.
Feldkircher macht vor Gericht wieder neue Angaben. Dem Gerichtspräsidenten Schreiber hat er bereits vor der Verhandlung die Mitteilung gemacht, er habe vor der Tat noch Holz gekauft, um die Entbindungskosten zu bezahlen – auch das erweist sich als unwahr. In der Verhandlung zeigt Feldkircher laut Zeitungsbericht „nur wenige Spuren von Reue“. Nach der Tat hatte er im Wirtshaus gekegelt und sich auch nichts anmerken lassen, als er den Vater des Opfers dort sah. Für das Opfer könne er nicht beten, erklärt er bei der Befragung durch den vorsitzenden Richter.
Falsche Versprechungen
Offenbar hatte Feldkircher dem späteren Opfer versprochen, sie zu heiraten, wenn das Kind ein Bub werde – unter der weiteren Voraussetzung, dass man ihn Jakob nennen müsse. Es sei ihm mit dem Versprechen aber nicht ernst gewesen. Feldkircher ist eigentlich mit Marie Sohm verlobt, die von seinem Verhältnis zu Susanne Feuerstein aber nichts wusste.
Er habe schon einmal darüber nachgedacht Susanne zu ermorden, habe da aber keinen Strick dabeigehabt, erklärt er weiter. Am 9. August habe er sich dann zum Mord entschlossen, weil er gewusst habe, dass die Hochschwangere, die nicht mehr zur Kirche gehen konnte, alleine zuhause war. Nach der Tat habe er die Tenne zugesperrt, damit keine Fliegen hineinkämen.
Die Mutter des Angeklagten versucht ihren Sohn zu verteidigen. Susanne Feuerstein sei „nicht einwandfrei“ gewesen und hätte nie die Zustimmung ihres Gatten für eine Hochzeit erhalten. Der Vater des Opfers widerspricht heftig. Der Gemeindearzt erklärt Feldkircher für unterdurchschnittlich intelligent „keinesfalls aber für geistesschwach“. Der Bürgermeister nennt ihn „teilweise schlau“. Ein Arzt aus der Valduna ortet „eine gewisse instinktive Schlauheit.“ Der zum Gutachter bestellte Amtsarzt attestiert dem Angeklagten den Bildungsstand eines Zweitklässlers. Wenn etwas seinen Verstand überschreite, beginne er zu fabulieren. Zusammenfassend kommt das Gutachten zum Schluss, dass Jakob Jeldkircher unter einem „erheblichen Grad von angeborenem Schwachsinn und von Verstandesschwäche“ leide. Eine die Zurechnungsfähigkeit ausschließende Erkrankung liege aber nicht vor. Die Tat sei bewusst begangen worden.
Dass das Gericht gleich drei Ärzte aufbietet, um die psychische Gesundheit des Angeklagten zu beurteilen, weist darauf hin, dass man ihm das obligatorische Todesurteil für den angeklagten Meuchelmord ersparen wollte. Doch obwohl Jakob Feldkircher nach Ansicht der Ärzte kognitiv eingeschränkt ist, halten sie ihn für zurechnungsfähig.
Hinzu kommen die, für den Angeklagten negativ ins Gewicht fallenden Begleiterscheinungen der Tat: Er hat nicht nur eine Schwangere ermordet, keine Reue gezeigt und seine Aussage mehrfach geändert, sondern auch das soziale Gefüge rund um das Opfer zerstört. Josef Feuerstein, Susannes Vater, kann seinen Hof ohne die Tochter nicht mehr bewirtschaften und muss ins Armenhaus. Am Ende folgt das Schwurgericht der Anklage und verurteilt Feldkircher zum Tod durch den Strang.
Täter und Opfer
Bereits im Februar wird Feldkircher von Bundespräsident Wilhelm Miklas zu 20 Jahren Kerker begnadigt. Das ist insofern erstaunlich, als auch eine Begnadigung auf eine lebenslange Haftstrafe anstelle der Todesstrafe möglich gewesen wäre. Vermutlich hat sich die Justiz für die Begnadigung ausgesprochen. Gerichtspräsident Martin Schreiber, der auch die Verhandlung geführt hat, ist Mitglied des Staatsrates – eines Organs der damals regierenden faschistoiden Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur. Als solches ist er gut vernetzt. Dank der Begnadigung wäre Feldkircher spätestens 1956, im Alter von 55 Jahren, entlassen worden.
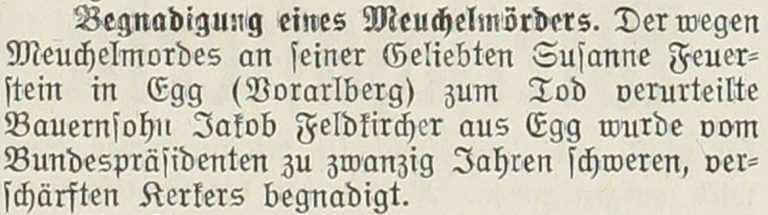
Doch 1938 marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein und die Nationalsozialisten beginnen damit, die Gesellschaft in ihrem Sinne umzugestalten. Gerichtspräsident Schreiber wird in den Ruhestand versetzt – nach dem Krieg wird er wieder Richter und Vorarlberger Landesstatthalter. Die NS- Diktatur beginnt außerdem damit, bestimmte Häftlinge in Konzentrationslager zu verlegen – unter ihnen Jakob Feldkircher. Er kommt ins KZ Neuengamme bei Hamburg und erhält die Häftlingsnummer 21257. Ob er ausgewählt wird, weil er nach den Maßstäben der Nazis als „asozial“ oder „geistesschwach“ gilt, ist nicht klar.
Lakonisch berichtet das Vorarlberger Volksblatt 1947 im Zusammenhang mit einem anderen Mordfall über die Tat Feldkirchers und dessen Schicksal. Er sei „während der nationalsozialistischen Herrschaft „an ,Herzschwäche‘“ verstorben. Ein verklausulierter ein Hinweis auf die gefälschten Totenscheine, die von den NS-Behörden für KZ-Häftlinge und Euthanasieopfer ausgestellt wurden. Wie diese Nachricht das Volksblatt erreichen konnte ist unklar, denn als Jakob Feldkircher am 25. Juni 1943 unter ungeklärten Umständen im KZ stirbt, wird der Totenschein der Familie offenbar nicht zugestellt. Erst 1962 gelangt er in die Hände der „Lagergemeinschaft Neuengamme“, einer Vereinigung ehemaliger KZ-Insassen. Diese bittet die Angehörigen sich zu melden und veröffentlicht in der Zeitschrift „Der Neue Mahnruf“ eine Liste österreichischer Opfer. Darin heißt es knapp: „Jakob Feldkircher, geboren 25. Mai 1901 in Egg, gest. 25. Juni 1943“.