Die Katastrophe hinter dem Beben
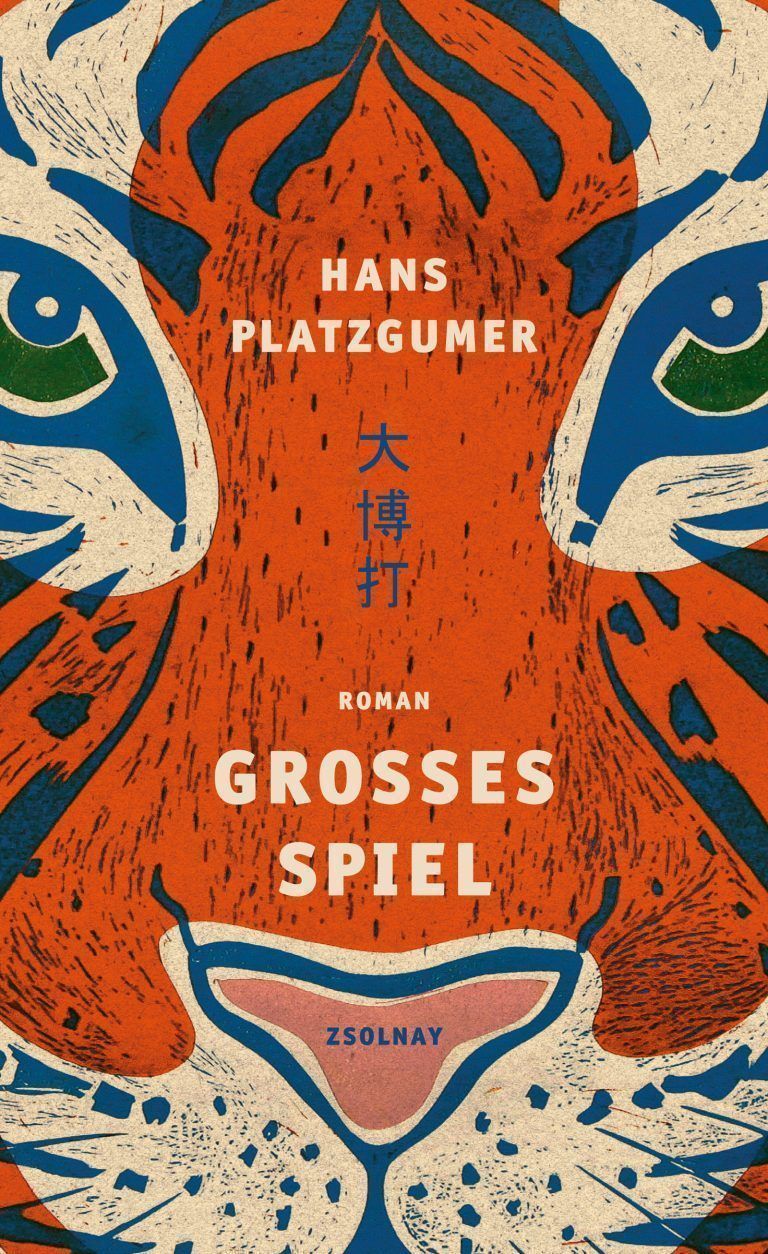
Heute Abend präsentiert Hans Platzgumer seinen Roman “Großes Spiel“ im T-Café des Vorarlberger Landestheaters.
Es ist das Jahr 1945, der Kaiser Japans hat seine Kapitulationserklärung abgegeben, und Hauptmann Masahiko Amakasu blickt ein letztes Mal zurück auf sein Leben – ein Leben, das er ganz in den Dienst der japanischen Geheimpolizei stellt. Von konservativen Werten durchdrungen und geblendet von den Traditionen des Kaiserreichs steht das patriotische Ziel über dem eigenen Urteilsvermögen.
Historische Geschehnisse
100 Jahre, nachdem das Kanto-Erdbeben weite Teile des Großraums Tokio verwüstete, präsentiert Hans Platzgumer seinen neuen Roman „Großes Spiel“, in dem nach historischen Vorlagen diese Naturkatastrophe zum Schlüsselmoment für verheerende politische Entscheidungen wird. Die Handlung beginnt 1912 mit der Inthronisierung des Taisho-Kaisers, einer kränklichen Persönlichkeit, die sich lieber mit chinesischen Gedichten die Zeit vertreibt, als über das Land zu herrschen.
Anders als seine Vorgänger entwickelt sich der neue Kaiser Yoshihito nicht zum autoritären Herrscher, sondern ist gesundheitlich der großen Verantwortung nicht gewachsen. In der geschwächten Monarchie verbreiten sich demokratisch-liberale und westliche Einflüsse, und Amakasu fühlt sich als Hauptoffizier der Armeepolizei verpflichtet, wieder für Ordnung zu sorgen. So beginnt seine jahrzehntelange Verfolgung des Anarchisten Sakae Osugi, in dessen Lebensentwürfen er sich immer mehr verliert.
Mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung berichtet Amakasu detailreich von den Denkweisen und dem Umfeld, in dem sich Osugi unter den politischen Aktivisten als Wegbereiter für alles Liberale profiliert. Zusammen mit seiner Partnerin, der Feministin Noe Ito, setzt dieser sich gegen die Unterdrückung und für die Freiheit ein. Intensiv hinterfragt und studiert Amakasu jeden Aspekt vom Leben eines Mannes, dem er unbewusst nacheifert und der ihm im Grunde genommen gar nicht so unähnlich ist: „Ich verglich mich mit ihm und merkte, wie ich, sein Richter, ihm eigentlich unterlegen war.“

Widersprüche
Sorgfältig verbindet Platzgumer die Erzählstränge der einzelnen Personen und gibt aus der Perspektive von Amakasu einen interessanten Einblick in die psychologische Beschaffenheit seiner Figuren. Behutsam bringt er die inneren Widersprüche zum Ausdruck, gegen die sich die Hauptfigur ein Leben lang zur Wehr setzt. Als Armeeoffizier führt er vor allen Dingen einen Kampf mit sich selbst, indem er unbeugsam seinen Ideologien folgt, auf die sich sein gesamtes Dasein stützt. Präzise hat Platzgumer die Gefühlsregungen der Figuren ausgearbeitet.
Vom Moment zu Beginn, als Amakasu in leicht steigender Nervosität die Verspätung des 123. Kaisers zur Kenntnis nimmt, bis zum Ende, wo er sich in Rechtfertigungen flüchtet, um die Fehler seines Handels nicht anerkennen zu müssen, zieht sich eine Figur, deren seelische Empfindungen unaufdringlich zur Sprache kommen, während sie versucht, mit verharmlosenden Worten zu erklären, wie es zu dem entscheidenden „Amakasu-Zwischenfall“ gekommen sei. „Ich würde lügen, würde ich behaupten, damals vorausgesehen zu haben, wie schnell dieses neue japanische Selbstbewusstsein in Hochmut und Übermut ausarten würde. […] Dennoch kommt es mir heute vor, als hätte ich das bevorstehende Unheil gespürt. Tief in mir verborgen setzte eine Skepsis ein, ein Zweifeln. Ich bilde mir das wahrscheinlich ein, im Nachhinein biegt sich der Mensch ja einiges zurecht.“
Beziehungsgeflecht
Häufig zieht der Autor Parallelen zwischen den Figuren. Beide, Amakasu und sein Kontrahent, blieben als Vertreter ihrer Sache standhaft bis in den Tod. Und wie Osugi hielt auch der Kaiser Yoshihito an neuartigen Ideen fest und träumte von einer Gesellschaft ohne hierarchische Klassensysteme. Doch während der Kaiser weltfremd und untätig in der Isolation vereinsamte, versuchte Osugi das Land zu reformieren.
Erzählerisch umkreist Amakasu das Kanto-Erdbeben, das politisch als Gelegenheit genutzt wurde, sozialistische und anarchistische Aktivisten zu ermorden. „So entsetzlich sich dieser erste Septembertag gestaltete, er markierte einen Wendepunkt. Jahrelang war die Geheimpolizei damit überfordert gewesen, den Aufruhr der Taisho-Zeit unter Kontrolle zu halten. Nun eilte uns die Natur zu Hilfe.“
In Großes Spiel hat Hans Platzgumer die Taisho-Zeit in eine emotionale Geschichte verpackt. Der Roman setzt sich zusammen aus historischen Figuren und Ereignissen, die der Autor erforschte, nachdem ihm sein Freund Carl Tokujiro Mirwald von einer Epoche erzählte, „in der noch mehr Unruhe geherrscht zu haben schien als jetzt“. Acht Jahre lang habe der Autor an dem Roman gearbeitet und darin auch Dynamiken zwischen ihm und seinem Vater wiedererkannt, der seinen konservativen Werten nach, selbst der Ich-Erzähler dieses Romans sein hätte können, wie Platzgumer in der Widmung am Ende des Buches schreibt.
Hans Platzgumer: „Großes Spiel“, Zsolnay Verlag, 336 Seiten, 26,80 Euro. Lesung: 5. Oktober, 19.30 Uhr, Vorarlberger Landestheater, T-Café, Bregenz.