Freischütz: Die Musik kämpft ums Überleben

Trotz starker Orchestermomente und überzeugender Stimmen dominiert in Stölzls „Freischütz“ die Optik.
Gruselkrimi und Hollywoodglitzer, ein omnipräsenter Teufel, der die Zeit vor und zurück dreht und nicht nur die Freikugeln lenkt, eine Winterlandschaft mit Schneehügel und Eisschollen und windschiefen Hütten: so stellt sich Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ auch im zweiten Jahr dar. Bei traumhaftem Wetter und stimmungsvollem Sonnenuntergang hinter Lindau erlebte das Publikum eine Festspielpremiere, die wieder mit viel Effekten und Spektakel auftrumpft, in ihrer Bilderfülle aber die Musik verdrängt.

Eingedampft
Insgesamt gibt es zu viele Widersprüche: Einerseits sind die Ouvertüre und einige Arien gekürzt oder gar gestrichen, sodass die Spieldauer auf seebühnentaugliche pausenlose zwei Stunden „eingedampft“ ist. Andererseits „erfindet“ Samiel (Moritz von Treuenfels im roten Trikot geschmeidig auf Baum- und Pferdegerippen tänzelnd) als Teufel, Strippenzieher, Conférencier und Regisseur neue Wendungen, die dann wieder gekippt werden.

Zwar ist der Text für Samiel vielleicht nicht mehr so ausufernd wie im letzten Sommer, doch warum muss er sich in die Arien von Max und Agathe einmischen, sie „weitersingen“, weiterdenken, obwohl er nun wirklich nicht singen kann? Ist das der Grund, warum einige der Hauptpartien im zweiten Jahr umbesetzt wurden? Es wirkt, als hätte Regisseur Philipp Stölzl nicht nur den zugegebenermaßen altmodischen Texten misstraut und sie deshalb (im Einvernehmen mit der früheren Intendantin Elisabeth Sobotka) umgeschrieben, sondern als empfände er auch die Musik lediglich als Hintergrund für seine Bebilderung, dabei ist sie doch der Spiegel der Emotionen…
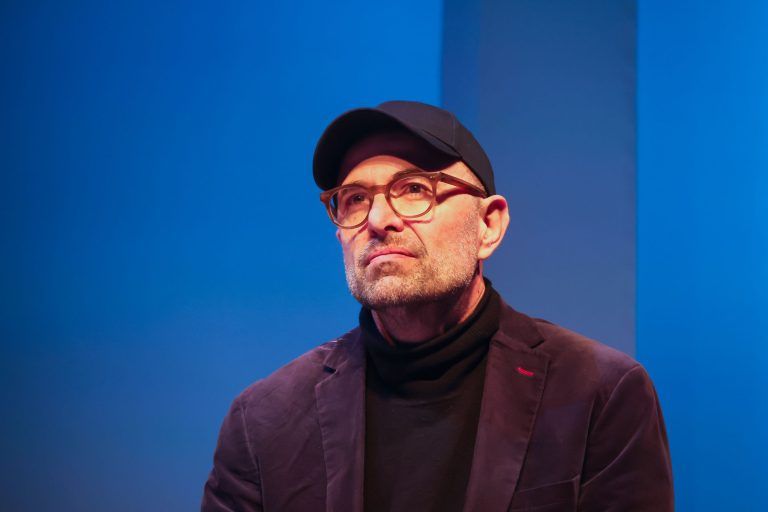
Die modernen „Frauengespräche“ von Agathe und Ännchen mögen auch nicht zur doch oft beschworenen Zeit des Dreißigjährigen Kriegs passen, von dem dieses Freischütz-Dorf erzählt. Die Tonspur, die zusätzlich mit krächzenden Vögeln, Glockenschlägen, unheimlichem Rauschen aufwartet, verstärkt die Grundstimmung. Dazu trumpfen natürlich der Bühnenzauber und die Farbexplosionen in der Wolfsschluchtszene auf, ebenso wie sich Nixen mit Glitzerkrönchen in den deutschen romantischen Wald eingeschlichen haben: Stölzl liebt den großen Pinsel und trägt dick auf.

Präsent und klangschön
Auch wenn die Bühne so dominiert, überzeugen die Wiener Symphoniker unter dem neuen Dirigenten Patrik Ringborg doch mit wunderbar warmen Hörnerklängen, plastischer Gestaltung in den Steigerungen, einem empfindsamen Cello-Solo (das Samiel mitzuspielen scheint) und feiner Beweglichkeit in den Holzbläsern. Präsent und klangschön abgemischt präsentieren sich auch die von Benjamin Lack und Lukáš Kozubik einstudierten Chöre aus dem Festspielhaus. Wie im letzten Jahr singt Katharina Ruckgaber ein quecksilbrig schlankes Ännchen mit strahlender Wärme, als Agathe stellt sich Irina Simmes mit leuchtendem Sopran und souveränen Koloraturen vor. Attilio Glaser gibt den als Schütze glücklosen, aber schwärmerisch liebenden Max mit schlankem und doch heldischem Tenor. Als vom Krieg traumatisierter Kaspar, der sich dem Teufel verschrieben hat, watet Oliver Zwarg durchs Wasser, Johannes Kammler als Ottokar im Hermelinmantel von König Ludwig und Frederic Jost im prächtigen Gewand eines Kirchenfürsten (unter dem sich Samiel verbirgt) tummeln sich ebenfalls auf Schneehügel und Eisscholle.

In ihrem Wimmelbild-Aktionismus ist diese „Freischütz“-Inszenierung der Gegenentwurf zum manchmal statischen „Œdipe“, der im Haus begeistert hat. Hat die eine Oper berührt, so bleibt die andere an der Oberfläche. Trotzdem, der Andrang auf Karten ist groß und die Seebühnenaufführungen werden die nächsten Wochen prägen.
Katharina von Glasenapp