So läuft ein Insolvenzverfahren ab

Das Insolvenzrecht ist komplex und für Laien schwer durchschaubar. Regina Nesensohn, die Standortleiterin des KSV 1870 Vorarlberg, erklärt, was passiert, wenn Unternehmen nicht mehr bezahlen können.
Ein Unternehmer hat Schulden und kann seine Rechnungen nicht mehr begleichen. Was ist nun die Vorgangsweise?
Regina Nesensohn: Im ersten Schritt sucht man einen Unternehmensberater und einen mit dem Insolvenzrecht vertrauten Rechtsanwalt auf. In einer Erstberatung blickt man gemeinsam auf die Betriebszahlen und schaut, in welche Richtung es geht. Besteht tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise die Überschuldung? Und welches Verfahren wählt man?
Welche Verfahren gibt es und wann eignet sich welches?
Nesensohn: Wenn das Unternehmen noch genügend Eigenkapital hat, macht ein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung Sinn. Wenn die Schulden aber höher als die Vermögen und sind und die Aufträge zurückgehen, läuft es auf ein Konkursverfahren hinaus.
Wodurch unterscheiden sich die Verfahren?
Nesensohn: Beides muss beim Insolvenzgericht beantragt werden. Der Konkursantrag kann vom Gläubiger – das ist eine Person oder Institution, der Geld geschuldet wird – oder vom Schuldner selbst gestellt werden. Ein Sanierungsverfahren kann ausschließlich vom Schuldner beantragt werden, denn dafür sind mehrere Unterlagen nötig: Fortbestehensprognose, Vermögensverzeichnis und ein Angebot für die Gläubiger. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung. Ohne Eigenverwaltung liegt die Mindestquote für die Gläubiger bei 20 Prozent, zu zahlen binnen zwei Jahren. Mit Eigenverwaltung liegt bei 30 Prozent binnen zwei Jahren, sie kann natürlich auch höher ausfallen. Der Vorteil eines Sanierungsverfahrens: Der Betrieb kann weitergeführt, die Arbeitsplätze behalten werden. Wird der Sanierungsplan erfüllt, kann das Unternehmen nach zwei Jahren schuldenfrei wieder durchstarten.

Bei einem Konkursverfahren gibt es keine Entschuldung nach zwei Jahren. Hier hat der Insolvenzverwalter – ein Rechtsanwalt, der vom Insolvenzgericht ernannt wird – die gesamte Insolvenzmasse bei sich und entscheidet, ob bei einer Verwertung des Unternehmens mehr für die Gläubiger herauskommt oder ob eine Umwandlung in ein Sanierungsverfahren vielversprechender ist. Wenn gar keine Insolvenzmasse vorhanden ist, kann ein Konkursverfahren auch mit einer Nullquote enden. Man spricht hier von einer Aufhebung mangels Kostendeckung.
Kann der Insolvenzantrag auch von einem Gläubiger eingebracht werden?
Nesensohn: Grundsätzlich ist der Unternehmer verpflichtet, einen solchen Antrag einzubringen. Bei Zahlungsunfähigkeit. Dafür gibt es eine Frist von 60 Tagen. Aber wenn eine fällige Zahlungsforderung nicht beglichen wird, kann der Gläubiger vorher schon beim Insolvenzgericht einen Konkursantrag einbringen. Dann gibt es eine Einvernahmstagsatzung. Dort werden der Schuldner und der Gläubiger eingeladen und die Sachlage wird besprochen. Alle Vermögenswerte werden angeschaut und der Richter entscheidet, ob es nur um eine Zahlungsstockung geht oder ob der Schuldner zahlungsunfähig ist.
Wovon hängt es ab, ob im Konkursfall ein Unternehmen fortgeführt werden kann?
Nesensohn: Von der Auftragslage. Steht ein großer Auftrag unmittelbar bevor, kann über eine Sanierung nachgedacht werden. Ein anderer Weg ist, sich Investoren heranzuholen oder bei der Bank einen Überbrückungskredit zu holen, um die Sanierung zu stemmen.
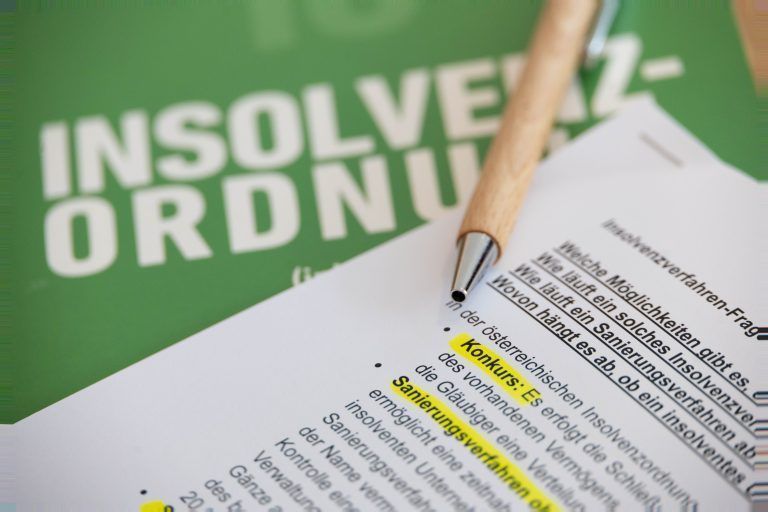
Was versteht man unter anerkannten beziehungsweise bestrittenen Forderungen?
Nesensohn: Die Gläubiger oder wir als Kreditschutzverband in Vertretung melden Forderungen an. Der Insolvenzverwalter schaut sich das gemeinsam mit dem Schuldner an. Bei der Berichts- und Prüftagsatzung wird dann das Anmeldeverzeichnis vorgelegt, wo aufgelistet wird, welche Forderungen anerkannt und welche bestritten werden. Für Letztere setzt das Insolvenzgericht eine Frist, in der die Parteien korrespondieren und sich schließlich auf eine Anerkennung einigen oder nicht.
Welche Aufgaben hat ein Kreditschutzverband?
Nesensohn: Wir, der KSV 1870, sind ein bevorrechtigter Kreditschutzverband. Das heißt, wir dürfen im Insolvenzverfahren die Interessen der Gläubiger vor Gericht vertreten, praktisch wie ein Anwalt in einem Strafprozess. Wichtig ist etwa die richtige und fristgerechte Anmeldung der Forderungen, ansonsten werden sie vom Gericht zur Verbesserung zurückgeschickt oder abgelehnt. Bei einer Sanierungsplantagsatzung, wo über den Sanierungsplan abgestimmt wird, bieten wir den Gläubigern an, sie stimmrechtlich zu vertreten. Es ist wichtig, dass möglichst viele Gläubiger mit abstimmen, denn ein Schuldner braucht die Kopf- und Summenmehrheit, damit der Sanierungsplan angenommen wird. Wer nicht mitstimmt oder uns nicht mit der Stimmabgabe beauftragt, schließt sich der Mehrheit an. Über Insolvenzverfahren hinaus bieten wir als Kreditschutzverband unseren Kunden Bonitätsprüfungen und Forderungsmanagement bei offenen Rechnungen an.
Kompakt
Sanierungsverfahren:
Ziel ist, das Unternehmen fortzuführen. Während des Verfahrens führt der Schuldner (mit Eigenverwaltung) oder der Insolvenzverwalter (ohne Eigenverwaltung) das Unternehmen. Ein Sanierungsplan wird erstellt. Bei Erfüllung ist der Schuldner von den Restschulden befreit.
Konkursverfahren:
Das Unternehmen wird von einem Insolvenzverwalter fortgeführt. Der Schuldner verliert die Verfügungsmacht über das Vermögen und wird nicht von den Restschulden befreit. Während des Konkursverfahrens kann auch ein Sanierungsplan vorgelegt werden.