Zwischen Baukultur und Bürokratie
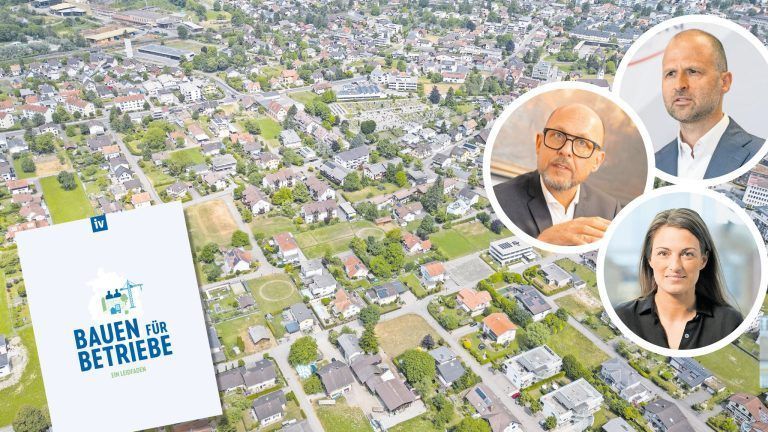
Die Industriellenvereinigung kritisiert Gestaltungsbeiräte als bürokratische Hürde, während andere ihre Bedeutung für die Baukultur betonen.
Die Diskussion über die Rolle und Effizienz der Gestaltungsbeiräte in Vorarlberg ist durch die Kritik der Industriellenvereinigung (IV) neu entfacht worden. In ihrem Leitfaden „Bauen für Betriebe“ bemängelt die IV bürokratische Hürden, uneinheitliche Vorgaben und eine häufig subjektive Entscheidungsfindung (Details dazu in der Factbox). Gleichzeitig betonen Befürworter wie die Stadt Bregenz, die Kammer der Ziviltechniker und das Land Vorarlberg die hohe Bedeutung der Beiräte für die Baukultur.
Aufgaben der Beiräte
Die Gestaltungsbeiräte erfüllen eine rein beratende Funktion, erklärt Landesrat Marco Tittler. Während der Landesgestaltungsbeirat (LGBV) große, raumrelevante Projekte bewertet und die Landesregierung unterstützt, entscheiden die Gemeinden eigenständig über ihre Beiräte. „Beiräte unterstützen die Entscheidungsträger mit Empfehlungen zur architektonischen und städtebaulichen Gestaltung“, so Tittler. Die Kammer der Ziviltechniker Tirol und Vorarlberg unterstreicht, dass Beiräte keine Vetomacht besitzen, sondern ausschließlich das Ortsbild- und Landschaftsschutzgesetz umsetzen. „Sie leisten einen großen Beitrag zur exzellenten Baukultur Vorarlbergs“, erklärt Kammerpräsident Hanno Vogl-Fernheim.
Bürokratie und Unsicherheit
Die Industriellenvereinigung wirft den Beiräten vor, Planungsunsicherheiten und Verzögerungen zu verursachen, wodurch die Baukosten für Unternehmen steigen. Als Beispiele nennt die IV mehrfach geforderte Änderungen an Fassadenfarben oder das Erfordernis eines zusätzlichen Untergeschosses, was die Baukosten um eine Million Euro erhöhte.
Tittler hält dagegen: „Wenn Beiräte frühzeitig eingebunden werden, können Projekte effizienter abgewickelt und gleichzeitig hohe Bauqualität gewährleistet werden.“ Die Kammer der Ziviltechniker fügt hinzu, dass Beiräte auch in kleineren Gemeinden eine Versachlichung in Entscheidungsprozessen bewirken, insbesondere dort, wo persönliche Beziehungen stark ins Gewicht fallen.
Baukultur
Für die Stadt Bregenz sind Gestaltungsbeiräte ein unverzichtbares Instrument zur Sicherung der Baukultur. Bürgermeister Michael Ritsch betont: „Unser Gestaltungsbeirat trägt wesentlich zur Sicherung der Baukultur bei, besonders in einer historisch geprägten Stadt wie Bregenz.“
Jährlich begleitet der Beirat in der Landeshauptstadt etwa 50 Projekte, darunter bedeutende städtebauliche Entwicklungen und private Bauvorhaben. Der Fokus liegt dabei auf einem harmonischen Zusammenspiel von Alt und Neu. Bürgermeister Ritsch räumt jedoch ein, dass die Arbeit des Beirats gelegentlich als zusätzlicher Aufwand wahrgenommen wird. Transparenz und frühzeitige Abstimmungen seien daher essenziell, um Konflikte weitestgehend zu minimieren.
Reformbedarf
Während die IV standardisierte Vorgaben für die Arbeit der Beiräte fordert, lehnen die Ziviltechniker eine zusätzliche Regulierung ab. Stattdessen plädiert die Kammer für eine stärkere Sensibilisierung der Bauherren, um die frühzeitige Einbindung der Gremien zu fördern.
Die Stadt Bregenz prüft neue Ansätze zur Weiterentwicklung der Beiratsarbeit. Eine mögliche Öffnung bestimmter Sitzungen für die Öffentlichkeit könnte den Dialog zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern fördern. Zudem wird über eine Erweiterung der fachlichen Expertise des Beirats durch Landschafts- und Freiraumplaner nachgedacht.
Balanceakt
In Bregenz etwa belaufen sich die jährlichen Kosten für die Arbeit des Gestaltungsbeirats auf 40.000 bis 50.000 Euro – eine Investition, die Bürgermeister Ritsch als wesentlich für die Qualität der Stadtentwicklung betrachtet. Obwohl Kritik an Verzögerungen und Planungsunsicherheiten nicht von der Hand zu weisen ist, zeigen Beispiele wie Bregenz, dass Gestaltungsbeiräte bei klaren Strukturen und frühzeitiger Einbindung sowohl Bauherren als auch Gemeinden unterstützen können. Entscheidend wird sein, wie die Zusammenarbeit in Zukunft gestaltet wird.
Kritik der IV
In „Bauen für Betriebe – Ein Leitfaden“ übt die Industriellenvereinigung Kritik am System der Gestaltungsbeiräte in Vorarlberg:
- Bürokratische Hürden
Uneinheitliche Vorgaben und ausufernde Verfahren verursachen Verzögerungen und steigende Kosten. In Vorarlberg benötigen Bauprojekte teils 17 Monate für Abstimmungen mit Gestaltungsbeiräten. - Subjektivität
Entscheidungen basieren oft auf ästhetischen Vorlieben. In einem Fall verdoppelte sich der Fassadenpreis durch Auflagen auf 600.000 Euro. - Planungsunsicherheit
52 der 96 Gemeinden haben Gestaltungsbeiräte, deren uneinheitliche Arbeitsweisen Unsicherheiten schaffen. - Verzögerungen
Rückmeldefristen von zwei Wochen werden häufig überschritten. Das Warten auf Entscheidungen verlängert die Planungszeit erheblich. - Wirtschaftliche Belastung
In einem Beispiel musste ein zusätzliches Untergeschoss gebaut werden, um eine Auflage zu erfüllen. Dies erhöhte die Kosten um 1 Million Euro (+10 Prozent) und führte zu einem höheren CO2-Verbrauch – entgegen den Nachhaltigkeitszielen. - Fehlende Kontrolle
Es gibt keine zentralen Standards für Gestaltungsbeiräte. Zudem sind viele Mitglieder in mehreren Beiräten aktiv, was aufgrund von Interessenskonflikten und mangelnder Verfügbarkeit Probleme schafft. - Regionale Unterschiede
Vorarlberg hat mit mindestens 52 Gestaltungsbeiräten eine der höchsten Dichten in Österreich – fast so viele wie der Rest des Landes zusammen.

Fünf Fragen an Verena Konrad, Direktorin Vorarlberger Architektur Institut (vai)
1. Welche Bedeutung haben die Gestaltungsbeiräte aus Ihrer Sicht für die architektonische Qualität und Stadtentwicklung in Vorarlberg?
Konrad: Die Gestaltungsbeiräte sind sehr bedeutsam für die architektonische Qualität und städte- und ortsbauliche Entwicklung in Vorarlberg. Sie beraten im Auftrag der Gemeinde über aktuelle Bauvorhaben und wirken darüber hinaus als Bildungsoffensive zu Themen wie Ortsbild, Dorfentwicklung und Baukultur. In Gemeinden, die Gestaltungsbeiräte transparent und kommunikativ einbinden, ist merkbar, wie sich Politik, Verwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft besser miteinander verständigen können und so Lösungen für alle Beteiligten entstehen. Dort, wo diese Gremien bewusst entwickelt wurden, zeigt sich eine hohe Qualität der Zusammenarbeit.
2. Wie tragen die Beiräte dazu bei, öffentliche Interessen und die Anforderungen der Bauherren zu vereinen?
Konrad: Gestaltungsbeiräte tagen im Auftrag der Gemeinde, wobei das öffentliche Interesse im Zentrum steht. Dieses mit den Wünschen der Bauherrschaft in Einklang zu bringen ist das Ziel. Damit das gelingt, braucht es ein verständnisvolles aufeinander zu Gehen. Die Bereitschaft, Kompromisse zu finden, ist entscheidend, auch wenn manche Interessenkonflikte bestehen bleiben.
3. Warum gibt es in Vorarlberg mehr Gestaltungsbeiräte als in anderen Bundesländern?
Konrad: Diese Darstellung ist so nicht ganz korrekt. In anderen Bundesländern haben Beiräte oft andere Bezeichnungen. Beispielsweise gibt es in Städten häufig mehrere Beiräte für unterschiedliche Themen. In Vorarlberg haben Gestaltungsbeiräte jedoch eine lange Tradition. Es handelt sich in Vorarlberg um ein bewährtes Erfolgsmodell, das von anderen Regionen wie der Schweiz, Deutschland und Frankreich kopiert wird.
4. Welche Konflikte treten in der Arbeit der Beiräte auf, und wie könnten diese gelöst werden?
Konrad: Die häufigsten Konflikte entstehen durch schwierige Kommunikation und unklare Abläufe mit der Verwaltung. Verzögerungen ergeben sich oft, wenn Prozesse nicht ausreichend geklärt sind. Auch Konflikte, die bereits im Projekt selbst angelegt sind, werden durch die Beiräte sichtbar. Zentral sind Transparenz, klare Kommunikation und ein regelmäßiger Rhythmus der Sitzungen. Ein früher Dialog ist entscheidend: Baugrundlagen sollten von der Gemeinde eingeholt und der Austausch vor Beginn der Planung gesucht werden. Das spart Zeit, Geld und Ärger.
5. Wie könnten die Gestaltungsbeiräte weiterentwickelt werden?
Konrad: Die Einbindung der Beiräte in Verwaltungsstrukturen und ein regelmäßiger Austausch mit politisch Verantwortlichen sind essenziell. Beiräte brauchen konkrete Aufträge: Worum soll es gehen? Welche Grundlagen gelten? Ebenso sollte sichergestellt werden, dass Bauwerber und Beiräte dieselben Informationen nutzen. Ein großes Problem ist der Personalmangel in Bauverwaltungen, der die Prozesse oft ausbremst. Hier wäre eine Investition notwendig. Die Kritik von Bauwerbern richtet sich selten direkt gegen Beiräte, sondern gegen die Dauer des Gesamtprozesses. Mit stärkeren Kapazitäten könnten Beiräte effektiver arbeiten, und die Bereitschaft, Anregungen zu akzeptieren, wäre höher.