Bergretter in Dornbirn: Zwischen Risiko, Selbstschutz und Hilfsbereitschaft

Bergretter wie Klaus Drexel setzen im Einsatz ihr Leben für andere aufs Spiel – oft aufgrund von Fahrlässigkeit, falscher Ausrüstung oder Selbstüberschätzung. Der 51-Jährige möchte niemanden verurteilen, betont einmal mehr die Gefahren am Berg.
NEUE am Sonntag: Sie sind seit vielen Jahren für die Sicherheit am Berg im Einsatz. Wenn Sie heute rund um Dornbirn blicken: Was hat sich verändert? Welche Einsätze beschäftigen die Bergrettung Dornbirn aktuell am meisten?
Klaus Drexel: Das Einsatzspektrum ist breit. Die klassischen Einsätze wie Verstauchungen, Überlastungen oder Selbstüberschätzung gibt es nach wie vor. Deutlich zugenommen haben aber Trendsportarten. Mountainbiken etwa – durch E-Bikes ist die Frequenz massiv gestiegen. Auch Canyoning ist stärker im Kommen. Dornbirn ist ein beliebtes Ziel, der Karreneinsatz etwa ist unvergessen. Unser Aufgabengebiet hat sich erweitert: Neben alpinen Notfällen stehen wir auch bei Sucheinsätzen, internistischen Notfällen im Gelände, Unwettern, Waldbränden oder Hochwasser im Einsatz. Die Arbeit ist vielfältiger und aufwendiger geworden.

NEUE am Sonntag: Trendsportarten wie Canyoning oder Mountainbiken ermöglichen vielen den schnellen Einstieg – auch ohne Erfahrung. Früher hieß es, man müsse sich den Gipfel verdienen. Führt das nicht zu mehr Risiken?
Drexel: Früher mussten Bergsportler ihre Touren mühsam planen, Literatur studieren, Erfahrungen sammeln. Heute wird alles angeboten: E-Bike-Verleihe, Klettergärten, Werbung in den sozialen Medien. Das macht den Zugang leichter, führt aber dazu, dass auch Menschen ohne Erfahrung in Situationen geraten, in denen sie nichts verloren haben. Ich sehe das als Entwicklung im Tourismus, die aber Gefahren mit sich bringt.

NEUE am Sonntag: Österreichweit verzeichnet die Bergrettung heuer Rekordeinsätze. Oft sind Menschen mit falschem Schuhwerk unterwegs oder überschätzen sich. Am Ende seid ihr es, die sich selbst Gefahren aussetzen müssen. Kommt da nicht Wut auf?
Drexel: Natürlich kann man das nachvollziehen. Aber wir sind Spezialisten für Bergungen und ich bin überzeugt: Niemand handelt absichtlich. Wenn ich diesen Glauben verlieren würde, müsste ich aufhören. Der Hauptgrund für Einsätze ist Selbstüberschätzung. Das ist menschlich. Ich vergleiche es mit Surfen: Auch dort kann man ohne Erfahrung rasch in Gefahr geraten. Verurteilen bringt nichts.
NEUE am Sonntag: Viele setzen auf teure Ausrüstung, im Winter beispielsweise Lawinen-Airbags, haben aber wenig Erfahrung. Reicht das?
Drexel: Ausrüstung schützt nicht vor Unfällen. Sie kann helfen, schwere Folgen zu verhindern, aber sie ersetzt keine Kenntnisse. Hier haben die alpinen Vereine wie Bergrettung, Alpenverein und Bergführerverbände eine Verantwortung: Menschen müssen im Umgang mit Ausrüstung geschult werden. Es gibt viele Initiativen, etwa Lawinenschulungen oder LVS-Tage. Aber man kann nicht die gesamte Freizeit abdecken.

NEUE am Sonntag: Im Tourismus wird versucht, möglichst viele Angebote auch im alpinen Gelände zu schaffen. Wie sehen Sie die Balance zwischen Sicherheit und Angebot?
Drexel: Wo Bahnen sind, sind Menschen. Das ist verständlich, schließlich kostet Infrastruktur viel Geld. Grundsätzlich sind die Angebote gut abgesichert. Aber mit mehr Menschen steigt das Unfallrisiko. Das ist eine normale Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Und dann braucht es uns.

NEUE am Sonntag: Gab es Einsätze, bei denen Sie nur noch den Kopf schütteln konnten?
Drexel: Ja, einige. Ein Wanderer am doch exponierten Heuberggrat im Kleinwalsertal etwa trug Flip-Flops. Er meinte nur: „Die trage ich immer.“ Oder der Klassiker im Winter, ein Tourengeher mit LVS-Gerät, aber nicht eingeschaltet. Ein anderer wollte sich mit dem Gürtel am Stahlseil in einem Klettersteig sichern. Solche Fälle sind absurd, aber gefährlich.
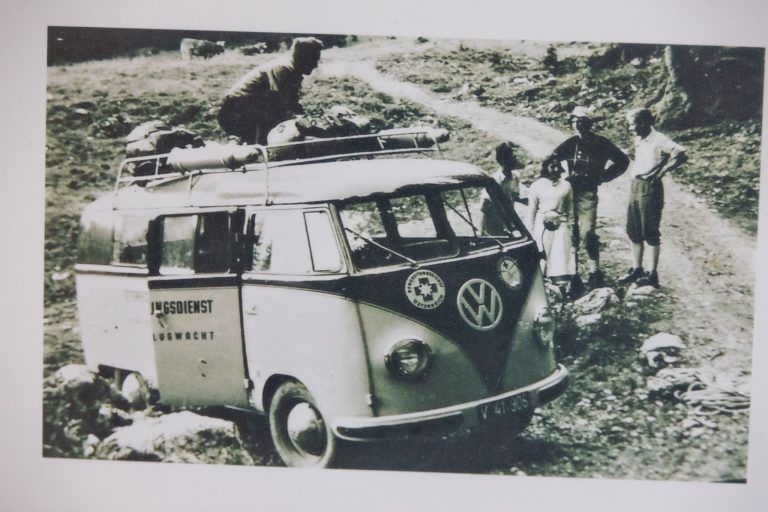
NEUE am Sonntag: Wer trägt eigentlich die Kosten für Einsätze – gerade bei Hubschraubern?
Drexel: Für uns zählt im Moment des Einsatzes nur das Retten. Kosten sind nebensächlich. Und wir arbeiten sicher nicht nach amerikanischem Vorbild à la „zuerst Visa, dann Rettung“. Natürlich gibt es Menschen, die nicht zahlen können oder keine Versicherung haben. Dann sucht man Lösungen. Hubschrauber kommen nur bei klarer Notarztindikation, etwa Schädel-Hirn-Trauma oder wenn eine Rettung aus dem Gebiet mit unverhältnismäßig langen Fußmärschen einhergehen würde. In Vorarlberg haben wir das Glück, eine gut funktionierende Flugrettung zu haben. Ohne sie wären manche Einsätze kaum möglich.

NEUE am Sonntag: Ein besonders prägender Einsatz war jener bei der Karrenseilbahn. Wie blicken Sie heute darauf zurück?
Drexel: Das war ein Einsatz, den niemand so schnell vergisst. Zunächst dachten wir an eine Routinebergung, doch innerhalb kürzester Zeit wurde klar, dass wir es mit einer potenziellen Katastrophe zu tun hatten. Die Seile waren beschädigt, vieles, was wir sonst geübt hatten, war so nicht mehr möglich. Wir durften drei Stunden lang nicht auf die Gondel, weil erst abgeklärt werden musste, ob sie überhaupt noch hielt. Diese Zeit haben wir genutzt, um die gesamte Rettung vorzubereiten – vom Material über die Koordination der Kräfte bis hin zur Betreuung der Menschen, sobald sie evakuiert würden. Als die Bahn schließlich freigegeben wurde, konnten wir strukturiert und sicher arbeiten. Ein Seilbahntechniker hat die Gondel zuerst gesichert, erst danach konnten zwei Bergretter zur Kabine geflogen werden. Für die Insassen war das Warten schlimm, für uns war es eine enorme Herausforderung, aber auch eine wichtige Lehre: Aus einer vermeintlich normalen Situation kann in Minuten etwas völlig Neues entstehen. Die Zusammenarbeit mit Polizei und Hubschraubern war dabei entscheidend. Ohne dieses perfekte Zusammenspiel wäre der Einsatz nicht so reibungslos verlaufen. Für mich war es eine „Beinahe-Katastrophe“, die am Ende aber gezeigt hat, wie wichtig Ausbildung, Erfahrung und Teamarbeit sind.

NEUE am Sonntag: Jeder Einsatz bringt Risiken. Wie treffen Sie Entscheidungen, wenn auch das Leben der Retter gefährdet sein kann?
Drexel: Selbstschutz hat oberste Priorität. Es gibt rote, gelbe und grüne Gefahrenzonen. In roten Zonen muss die Person schnell herausgeholt werden, aber niemand darf leichtfertig Risiken eingehen. Letztlich entscheidet jeder Retter für sich, aber auch die Einsatzleitung hat eine wichtige Rolle. Vertrauen im Team ist entscheidend. Es ist eine große Verantwortung, weil man nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Kameraden mitdenkt. Ich weiß, dass viele Bergretter bereit wären, für andere an ihre Grenzen zu gehen – manchmal auch darüber hinaus. Genau da braucht es eine starke Einsatzleitung, die im richtigen Moment bremst und den Überblick behält. Es ist oft schwer, Kameraden zurückzuhalten, wenn sie helfen wollen, aber das ist notwendig. Denn niemand darf wegen eines Einsatzes sein Leben verlieren. Diese Balance zwischen Helfen und Schützen ist die größte Herausforderung unserer Arbeit.
NEUE am Sonntag: Viele Einsätze passieren im Winter. Was unterscheidet diese von anderen und wo liegen die größten Gefahren?
Drexel: Der Winter ist besonders anspruchsvoll. Lawinengefahr ist ein ständiges Thema – schon bei der Anfahrt zum Einsatzort. Jeder Schritt in einen Hang birgt ein Risiko. Wir haben klare Regeln, welche Hänge wir betreten dürfen und wann nicht. Doch selbst mit bester Ausbildung bleibt ein Restrisiko. Dazu kommen Kälte, Dunkelheit und Erschöpfung. Oft dauern Wintereinsätze länger, weil der Transport schwieriger ist und die Witterung die Arbeit massiv erschwert. Ein einfacher Knöchelbruch kann im Skigebiet einen Hubschraubereinsatz auslösen, weil ein Abtransport mit der Akja über Stunden nicht zumutbar ist. Wir müssen in der Ausbildung lernen, die eigene Belastungsgrenze zu erkennen und trotzdem professionell zu arbeiten. Der Winter verlangt höchste Konzentration – Fehler verzeiht er kaum.

NEUE am Sonntag: Die Bergrettung arbeitet ehrenamtlich. Wie schwer ist es, Nachwuchs zu finden und zu halten?
Drexel: In Vorarlberg genießt das Ehrenamt hohen Stellenwert. Viele Junge wollen zur Bergrettung. Schwieriger ist es, sie langfristig zu halten. Die Ausbildung wird aufwendiger, die Arbeit professioneller. Funktionärsaufgaben kommen dazu. Das alles mit Beruf und Familie zu vereinbaren, ist die größte Herausforderung. Arbeitgeber, die das unterstützen, sind für uns unverzichtbar.
NEUE am Sonntag: Neben der körperlichen Belastung gibt es die psychische. Manche Einsätze sind schwer zu verarbeiten. Wie geht man damit um?
Drexel: Solche Einsätze gibt es, und sie gehen an niemandem spurlos vorbei. Wir lernen in der Ausbildung nicht nur physische, sondern auch psychische Erste Hilfe. Wichtig ist der Zusammenhalt: dass man nach einem Einsatz nachfragt, wie es den Kameraden geht. Meistens hilft es am meisten, mit jenen zu sprechen, die dabei waren. Natürlich kann man auch professionelle Hilfe wie das KIT hinzuziehen. Aber am wertvollsten ist oft das Gespräch im Team. Jeder geht damit anders um – entscheidend ist, niemanden allein zu lassen.
NEUE am Sonntag: Sie selbst sind privat viel in den Bergen unterwegs. Wie gehen Sie persönlich mit Risiko um?
Drexel: Ich habe schon eigene Erfahrungen gemacht, die mich geprägt haben – etwa zwei Mal unter einer Lawine. Wenn man einmal echte Todesangst gespürt hat, verändert das vieles. Früher habe ich Rennen bestritten, Skitourenwettkämpfe. Ich erinnere mich an Herausforderungen, die ich heute nie mehr in Kauf nehmen würde – damals war das für mich normal. Heute frage ich mich: Wie konnte ich dieses Risiko eingehen? Mit zunehmendem Alter wächst der Respekt. Ich drehe lieber einmal um, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass etwas nicht passt. Früher habe ich die Grenze immer weiter verschoben. Heute schätze ich die Berge anders: Sie sollen mir Freude bereiten, nicht Angst. Ich will noch viele Jahre gesund mit meiner Familie unterwegs sein. Das Risiko ist mir diesen Kick nicht wert.

NEUE am Sonntag: Zum Abschluss: Was würden Sie Menschen mitgeben, die in die Berge gehen?
Drexel: Vorbereitung ist entscheidend. Jeder sollte wissen, worauf er sich einlässt, und die eigenen Grenzen realistisch einschätzen. Respekt vor der Natur ist unerlässlich. Die Berge sind wunderschön, aber alpines Gelände. Wer das im Kopf behält und auf sein Bauchgefühl hört, ist gut beraten. Und: Keine Vorverurteilungen. Jeder kann in Not geraten – entscheidend ist, wie wir miteinander umgehen.

Zur Person:
Klaus Drexel ist 51 Jahre alt und lebt in Dornbirn. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Beruflich arbeitet er als Leiter eines Betonwerks. Zudem ist er Ortsstellenleiter der Bergrettung Dornbirn. In seiner Freizeit geht er gerne Bergsteigen, unternimmt Skitouren, paragleitet und fährt Mountainbike. Die Liebe zum Berg teilt er mit seiner Frau Barbara.
(NEUE am Sonntag)