Lesertrend rückläufig: Wie Online-Riesen den Buchmarkt verändern
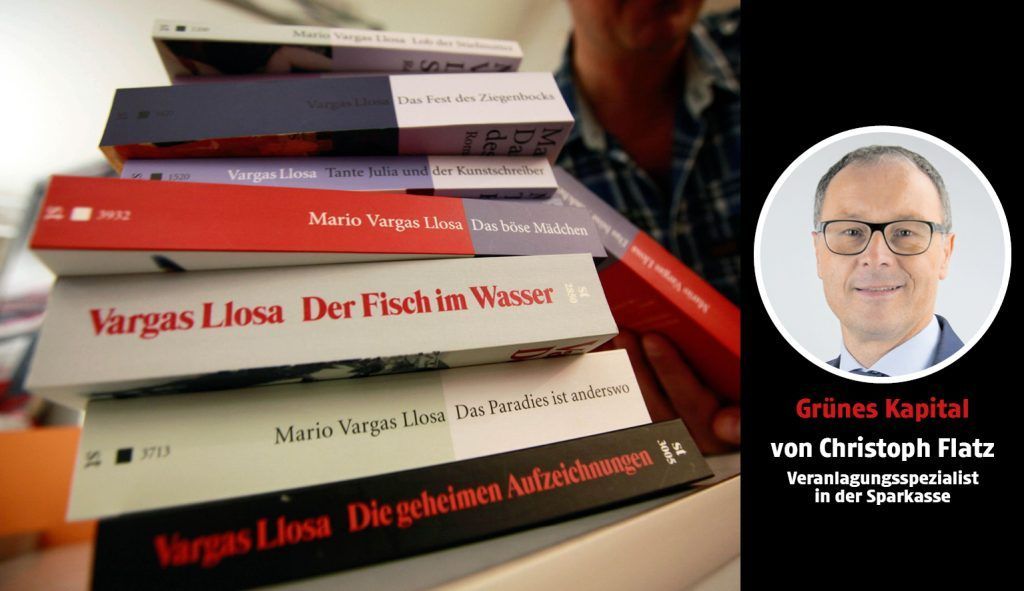
Frauen lesen mehr als Männer und ältere Menschen mehr als jüngere. Tendenziell greifen Akademiker häufiger zum Buch als Nicht-Akademiker. Unsere deutschen Nachbarn verbrachten 2022 durchschnittlich 27 Minuten pro Tag mit Lesen – fünf Minuten weniger als 2012.
Von Christof Flatz
neue-redaktion@neue.at
Auch in Österreich zeigt sich der Trend rückläufig. Doch nicht nur das veränderte Medienverhalten macht der Buchbranche zu schaffen. Auch steigende Kosten für Energie und Papier setzen Verlage und Händler unter Druck. Besonders der stationäre Buchhandel steht vor großen Herausforderungen: Zwischen 2022 und 2023 gingen die Buchverkäufe in Österreich um rund fünf Prozent zurück. Kleine, unabhängige Buchhandlungen kämpfen zunehmend um ihre Existenz – nicht zuletzt wegen der Übermacht großer Online-Plattformen.
Amazon bleibt auch 2025 der weltweit größte Online-Buchhändler – sowohl für gedruckte Bücher als auch für E-Books. In Ländern wie Deutschland, den USA oder Großbritannien dominiert der Internet-Gigant das E-Commerce-Buchsegment mit einem geschätzten Marktanteil von über 50 Prozent. Gestartet mit der Vision, alle Bücher der Welt von einem Ort aus anzubieten, gründete Jeff Bezos das Unternehmen 1995. Heute erzielt Amazon einen Gesamtumsatz von 167,7 Milliarden US-Dollar (zweites Quartal 2025) – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Buchbereich ist in dieser Summe zwar nicht separat ausgewiesen, zählt aber zum starken Nordamerika- und International-Segment mit über 136 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der Marktführer in Nordamerika und Europa fasst nun auch zunehmend in Asien Fuß.
Dabei ist die Konkurrenz in Fernost groß: So dominiert die Alibaba Group den chinesischen Online-Buchhandel über Tmall und Taobao. Diese gelten als wichtigste digitale Marktplätze für Bücher. Alibaba profitiert von einem integrierten Ökosystem, das neben dem E-Commerce auch Logistik, Zahlungsdienste und Cloud-Infrastruktur umfasst – und so einen schnellen, kostengünstigen Buchvertrieb ermöglicht. Zunehmend wird der Internet-Riese auch international aktiv.
Ob stationärer oder Online-Buchhandel nachhaltiger ist, kann nicht genau eruiert werden. Bei Online-Bestellungen fallen bis zu 400 Gramm CO₂ pro Kauf an. Fährt man fünf Kilometer mit dem Auto zur Buchhandlung, entstehen rund 1.100 g. Dafür sind Verpackungsverbrauch und Retourenquote im stationären Handel meist geringer. Insgesamt entwickelt sich der Buchhandel aber zu einer Branche, die Nachhaltigkeit zunehmend integriert – von der Produktion bis zur gesellschaftlichen Wirkung.
