Die Solidarität der Jugendlichen

Martin Hagen über Jugendliche in Coronazeiten
Wie geht es Jugendlichen in dieser Zeit?
Martin Hagen: Sie haben eine bemerkenswerte Solidarität mit der älteren Generation an den Tag gelegt. Wir, also die Offene Jugendarbeit Dornbirn, haben gleich zu Beginn eine Gruppe von mobilen Jugendarbeitern auf die Straße geschickt. Das waren vier Teams, die jeden Tag im ganzen Stadtgebiet unterwegs waren. Diese stellten in den ersten drei Wochen zu unserer Überraschung fest, dass fast keine Jugendlichen im öffentlichen Raum anzutreffen waren. Sie blieben entgegen unseren Erwartungen die ganze Zeit zu Hause. Erst, als die ersten Lockerungen kamen, waren sie wieder verstärkt unterwegs..
Warum haben sie sich so konsequent daran gehalten?
Hagen: Ich glaube, dass Jugendliche – entgegen dem üblichen Vorurteil ihnen gegenüber – einen großen Respekt gegenüber älteren Menschen haben und aus Solidarität heraus den Corona-Maßnahmen bedingungslos Folge leisteten. Ausnahmen gab es schon, aber da muss man auch die Hintergründe betrachten.
Das heißt?
Hagen: Es gab einige Ausnahmen bei Jugendlichen mit Fluchthintergrund, die aufgrund der Quartierslage nur schwer zu Hause bleiben konnten. Sie lesen aber auch keine Zeitungen oder hören Nachrichten, sondern sind vorwiegend in sozialen Netzwerken unterwegs, sodass sie oft einfach nicht informiert waren. Unsere Jugendarbeiter konnten etwa am Dornbirner Bahnhof immer wieder feststellen, dass zum Beispiel der Umstand, nicht mit einem Bekannten oder Freund unterwegs sein zu dürfen, nicht verstanden wurde. Das war an diese Gruppen kaum weitergegeben worden.
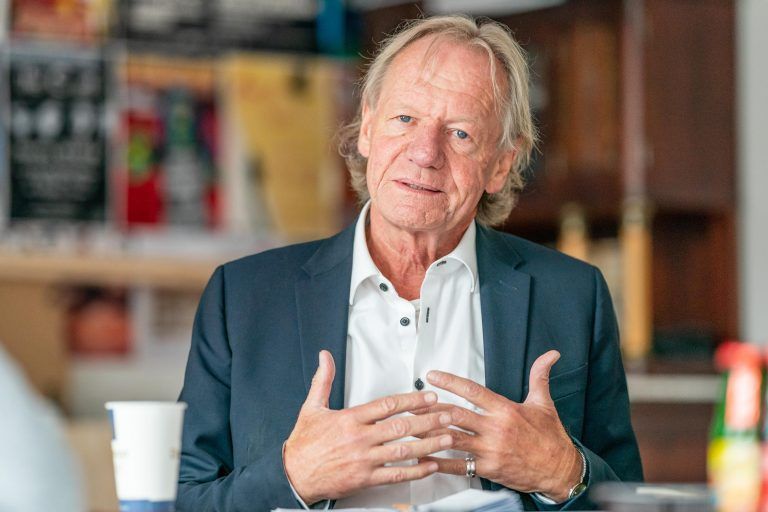
Wie belastend war es prinzipiell für Jugendliche, ihre Freunde nicht mehr treffen zu können?
Hagen: Sehr. Jugendliche haben in der Zeit, in der sie sich von ihren Eltern ablösen sollten, den ganz großen Drang, mit einer gleichaltrigen Gruppe unterwegs zu sein. Diese notwendige Auseinandersetzung in der Peergroup mit diesem zum Teil auch schmerzhaften Ablöseprinzip fiel über weite Strecken komplett flach.
War das Digitale, mit dem Jugendliche sicher vertrauter sind als alte Menschen, kein Ersatz?
Hagen: Schon ein Stück weit, aber vielleicht ein Vergleich: Wir Erwachsene hatten zahllose Videokonferenzen und konnten die wichtigsten Facts austauschen. Es fehlte aber der informelle Anteil mit Mimik, Gestik und Ähnlichem. Das fällt bei digitalen Kommunikationsformen weg. Natürlich gab es auch bei Jugendlichen Abmachungen, sich zu treffen, aber das war kaum möglich. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass man ultra hart bestraft wird. Da gab es wenig Pardon.
Worunter haben die Jugendliche am meisten gelitten?
Hagen: Jugendliche sind wie gesagt darauf angewiesen, diesen Ablöseprozess von den Eltern in ihrer gleichaltrigen Freundesgruppe zu besprechen. Wenn man Jugendliche isoliert, verwelken sie. Ältere Menschen sind es eher gewöhnt, allein zu sein. Jugendliche sind ohne Freunde auf sich allein gestellt.

Haben Sie von verstärkten familiären Konflikten in dieser Zeit gehört?
Hagen: Das hängt stark von den Wohnverhältnissen ab, ob man die Corona-Zeit gut oder schlecht übersteht. Wir wissen von Jugendlichen, die einen Garten hatten und dort konnte man sich auch treffen. Bei Jugendlichen, die in Kleinstwohnungen leben müssen, setzten sich in nahezu allen Belangen die Eltern durch. In dieser Enge, dieser ungewohnten Nähe, in der sie nicht mehr Luft holen konnten, waren sie praktisch zwangsbeglückt, ständig mit Geschwistern und Eltern zusammen sein zu müssen. Das war für viele sehr hart, vor allem, wenn man über wenig Ressourcen verfügt, arm ist.
Haben Ihnen die jungen Menschen auch von positiven Erfahrungen in dieser Zeit erzählt?
Hagen: Ja, wir haben von vielen Jugendlichen gehört, die Hilfestellung beim Einkaufen geleistet haben. Eines war am Anfang auch sehr interessant. Der Großteil der Jugendlichen hat die Maßnahmen sehr schnell umgesetzt. Erheblich schwieriger war dies bei älteren Personen. Ganz viele ältere Menschen gingen genau gleich einkaufen wie zuvor, nämlich in mindestens drei Geschäfte. 80-Jährige waren in den ersten Wochen wesentlich schwieriger im Umgang, das haben die mobilen Jugendarbeiter regelmäßig berichtet. Und noch etwas hat uns irritiert.
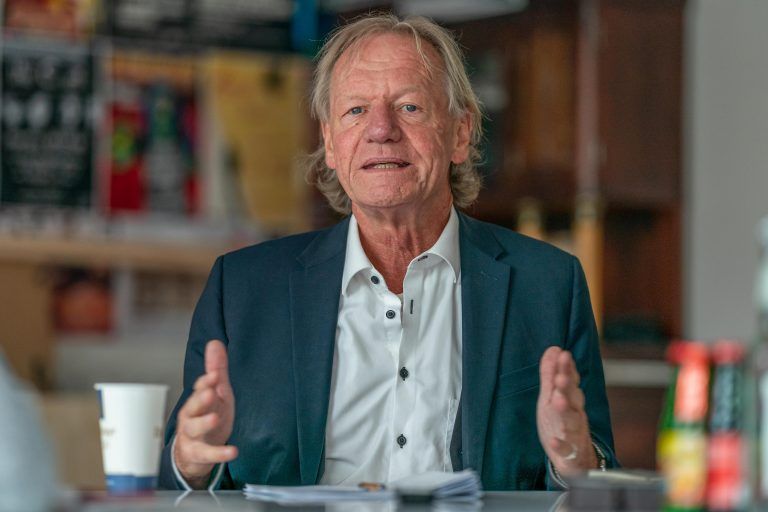
Was?
Hagen: Wir beschäftigen uns allein hier in der Offenen Jugendarbeit Dornbirn mit 26 Anzeigen der Polizei. Da sind schwere Strafen bis zu 850 Euro dabei, für Lehrlinge, für Asylwerber, für Jugendliche ohne Eltern. Das ist nicht bezahlbar. Wir geben ihnen rechtliche Tipps und haben alle Fälle beeinsprucht. Es kommen jetzt Strafmilderungen, aber wir bleiben dran und warten auf höchstgerichtliche Entscheidungen. Wir sind diesbezüglich auch mit der Volksanwaltschaft und der Kinder- und Jugendanwaltschaft in engem Kontakt und hoffen auf eine vernünftige Lösung. Die Strafen sind völlig überzogen. Bestraft wurden in erster Linie Jugendliche mit einer gewissen Bildungsferne und einem Armutshintergrund.
Hatten und haben die Corona-Maßnahmen auch berufliche Auswirkungen für Junge?
Hagen: Allerdings, nach einer Linzer Studie verdoppelt sich der Anteil der bedürftigen Jugendlichen. Wir müssen damit rechnen, dass viele zu einer abgehängten Generation zählen werden, vor allem jene, die ein bisschen Startschwierigkeiten im Bildungssystem haben und das hängt auch immer mit den Ressourcen der Eltern zusammen. Derzeit haben wir auch die Situation, dass zugesagte Lehrstellen wieder abgesagt werden, weil die Betriebe nicht wissen, wie es weitergeht.
Es erwischt die, die es vorher schon schwer hatten, nochmal verstärkt?
Hagen: Genau.
Haben Sie den Eindruck, dass die Restriktionen für die jungen Menschen nachvollziehbar waren?
Hagen: Mit der Zeit schon, wobei Jugendliche von der Krankheit selber ja kaum betroffen sind. Aber in der älteren Generation waren die Ängste groß und wurden auch geschürt und viele Jugendliche haben sich da rein aus Solidarität zurückgehalten. Dafür gebührt ihnen eigentlich ein Lob.
Wie anfällig sind Jugendliche eigentlich für Verschwörungstheorien?
Martina Nachbaur: Es ist ein Thema, weil sich Jugendliche verstärkt in den sozialen Medien bewegen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie anfälliger sind als Erwachsene. Aber wir haben gesehen, dass alte Verschwörungstheorien aus der Mottenkiste geholt und wieder neu mit Corona verpackt werden.

Was hören Sie da?
Hagen: Die Bill-Gates-Geschichte, dass große Mächte hinter allem stehen, die Geschäfte machen wollen …
Nachbaur: … dass es da einen kleinen Kreis gibt, der die ganze Welt kontrolliert und das war jetzt ein Versuch, zu schauen, wie kontrollierbar Massen sind.
Wie gehen Sie damit um?
Nachbaur: Wir machen ja sehr viel mit Medienkompetenz und Quellenkritik und deswegen fragen wir auch, woher hast du die Information, was könnte dahinterstecken. Aber ich habe den Eindruck, dass die Jugendlichen eher unsicher sind und fragen, und weniger, dass sie wirklich überzeugt davon sind.
Wie optimistisch bzw. pessimistisch blicken Jugendliche eigentlich in die Zukunft und wie hat sich das durch Corona geändert?
Hagen: Wenn Jugendliche nie in Arbeit waren, gehen sie nicht zu Institutionen wie dem AMS, weil sie keine Leistungen bekommen. Wenn dieser Übergang Schule, Arbeitsplatz nicht auf Anhieb klappt, gibt es viele Theorien, wie man sich sonst durchschlagen kann. Da ist die Politik gut beraten, rasche Hilfsmaßnahmen anzubieten für jene Jugendliche, die sonst zwischen Schule und Arbeitsplatz verloren gehen. Jugendliche, die drei, sechs, zwölf Monate ohne Beschäftigung sind, die erreicht im Bestfall dann nurmehr die Offene Jugendarbeit oder die Polizei im öffentlichen Raum. Letztere hat aber nicht die Aufgabe, sie sozial zu integrieren. Da kann es dann zu Effekten kommen, die sehr sehr teuer für uns als Gesellschaft werden – wenn sich Jugendliche überflüssig fühlen und das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden.
Was muss da konkret passieren?
Hagen: Firmen sollten zum Beispiel ermutigt werden, dass sie Jugendlichen trotz allem eine Lehrstelle anbieten. Wir von der Offenen Jugendarbeit Dornbirn würden hier Unternehmen auch unterstützen, indem wir etwa den Jugendlichen in Deutsch, Mathe und Englisch in der Berufsschule helfen. Das machen wir und das funktioniert sehr gut. Da können wir ein Stück weit Sicherheit geben, dem Jugendlichen und der Firma, sodass der Lehrabschluss viel wahrscheinlicher wird.
Haben Sie den Eindruck, dass den politisch Verantwortlichen dieses Problem nicht bewusst ist?
Hagen: Ja schon, aber da muss jetzt rasch gehandelt werden. Es wurden im Frühjahr viele Lehrstellen mündlich zugesagt und die gibt es jetzt doch nicht. Diese Jugendlichen sind aber zum Teil nicht mehr schulpflichtig und da nützen die behördlichen Briefe, die man ihnen schickt, auch nicht immer, weil die oft einfach mit Werbung verwechselt und weggeworfen werden.