„Den Gemeinden steht das Wasser bis zum Hals“

Rechtzeitig zur Gemeindewahl am 16. März ist nun das Buch „Kommunalwahlen in Vorarlberg 1950–2020“ erschienen. Ein Gespräch mit Wolfgang Weber, einem der Herausgeber und Autoren.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Gemeindewahlen als „second order elections“ gelten, also als zweitrangig im Vergleich zu anderen Urnengängen. Warum?
Wolfgang Weber: Es gibt eine Vorstellung, dass es eine Hierarchie innerhalb der Politik gibt, zuerst die Bundesebene, dann die Länder und dann die Gemeinden. Aber spätestens seit der Europarat 1988 die Charta der kommunalen Selbstverwaltung verabschiedet hat, ist klar, dass diese drei Ebenen von Politik gleichrangig sind.
Ist das auch im Bewusstsein der Bevölkerung so?
Weber: Bei Gemeindewahlen ist die Bindung an die Politiker stärker. Der Gemeindeverband hat im Vorjahr eine seiner regelmäßigen Umfragen gemacht, bei der es um die Bindung und die Glaubwürdigkeit der Politiker auf den drei Ebenen geht. Dabei schneiden die Gemeinden immer mit deutlichem Vorsprung am besten ab.

Andererseits ist die Wahlbeteiligung geringer als bei Landes- oder Bundeswahlen …
Weber: Das ist eine neue Entwicklung. Das war lange umgekehrt. In kleinen Gemeinden ist sie aber immer noch sehr hoch.
In größeren Gemeinden und Städten und im Landesschnitt ist sie aber eingebrochen.
Weber: Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass dort eine Entfremdung mit der Politik stattgefunden hat. Und ein Großteil der Bevölkerung lebt im Rheintal und im Walgau, wo die größeren Gemeinden sind.
Haben Sie eine Idee, wie die Wahlbeteiligung gesteigert werden könnte?
Weber: Dazu machen wir auch im Buch Vorschläge. Online- oder E-Voting wären Möglichkeiten, eine Verstärkung der partizipativen Demokratie oder mehr Möglichkeiten auf dem Stimmzettel, etwa das Verteilen der Stimmen auf Kandidaten verschiedener Listen. Und wenn die Gemeinde tatsächlich die „Schule der Demokratie“ ist, dann müssen einfach mehr Initiativen oder Möglichkeiten geboten werden, um die Menschen direkter zu beteiligen.

Ein Vorarlberg-Spezifikum ist die Mehrheitswahl. Wie sinnvoll ist sie?
Weber: Diejenigen, die sie machen, sind davon überzeugt. Meine persönliche Meinung ist, dass sie nicht sinnvoll ist. Wir haben in Österreich eine Verfassung, in der steht, dass unsere Richtschnur die Verhältniswahl ist. Wenn auf Kommunalebene unterschiedliche Wahlsysteme zulässig sind, ist das nicht im Sinne dieser Demokratie.
Diesem Verständnis würden dann auch die Einheitslisten widersprechen?
Weber: Die sind sogar noch ein bisschen restriktiver, weil bei der Mehrheitswahl kann zumindest jeder, der will, gewählt werden. Bei der Einheitsliste habe ich schon die Vorauswahl und kann nicht direkt mitsprechen.
Mehrheitswahl und Einheitslisten in den kleinen Gemeinden kommen ja meist zustande, weil es nicht genügend Kandidaten und Kandidatinnen gibt, oder?
Weber: Es sind sicher Möglichkeiten, die Beteiligung und Bindung zu erhöhen. Je kleiner Gemeinden sind, desto mehr rücken parteitaktische Überlegungen in den Hintergrund und stehen gemeinsame Fragen im Vordergrund. Das heißt allerdings nicht, dass in einer Mehrheitswahl keine ideologischen Positionierungen da sind. Aber sie stehen nicht im Vordergrund.

Laut einem Beitrag im Buch waren Wohnen und Verkehr schon bei der ersten Gemeindewahl 1950 zentrale Themen. Gibt es auch Veränderungen in der Themenlage?
Weber: Bis in die 1970er-Jahre gab es auf Gemeindeebene nicht so einen Wahlkampf wie bei Landes- und Bundeswahlen mit thematischen Positionierungen. Sondern es waren wirklich die Klassiker, die mich als Bürger in der Gemeinde konkret betreffen. Das war Wohnen, das war Verkehr, dann Raumplanung. Das Sozialthema zum Beispiel kam dabei eigentlich nie vor.
Ändert sich das dann?
Weber: Ja, so ab den 1980er-Jahren tauchen ganz lokale Themen auf. Ein Beispiel dafür wäre Michael Ritsch bei der Gemeindewahl 2020 in Bregenz, der ganz bewusst auf lokale Themen gesetzt hat. Bis in die 1980er-Jahre hatten wir das so nicht.
Vorarlberg hat die wenigsten Bürgermeisterinnen bundesweit. Wieso ist das so?
Weber: Eine These, die da immer kommt: Weil Vorarlberg ein konservativ regiertes Land ist, gibt es weniger Frauen in der Politik.
Es gibt in Österreich auch andere konservativ regierte Bundesländer, die aber mehr Bürgermeisterinnen haben.
Weber: Wenn ich ein politisches Mandat anstrebe, muss ich in einer Partei sein. Und da muss ich die ganze Ochsentour durchlaufen und die ist männlich dominiert. Die Parteien haben zwar Frauenorganisationen, aber die sind eher schwach. In Vorarlberg sind auch in den Gemeindevertretungen relativ wenig Frauen. Wenn ich Frauen an der Spitze haben will, brauche ich sie auch in der Breite und das fehlt. Dazu kommt, dass die externe Kinderbetreuung in anderen Bundesländern früher und besser funktioniert hat. Und bei uns wirkt das traditionelle Bild „Frau zuhause, Mann draußen“ wohl auch noch länger nach.

Am 16. März finden die nächsten Gemeindewahlen in Vorarlberg statt. Angesichts dessen, dass nahezu alle Kommunen mit schweren finanziellen Problemen kämpfen, wie kann deren Zukunft ausschauen?
Weber: Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wenn es um Finanzen geht, ist die, dass über Aufgaben gesprochen werden muss. Das sagt ja auch der Gemeindeverband. Es muss grundsätzlich über die Aufgabenverteilung gesprochen werden. Den Gemeinden steht das Wasser finanziell bis zum Hals. Daher sollten Dinge auf eine höhere Ebene abgegeben werden, etwa die Raumplanung.
Ein Ansatz sind ja auch Kooperationen, oder?
Weber: Ja, da gibt es mittlerweile viele. Die werden auch im Buch besprochen. Es braucht aber eine Möglichkeit der Aufgabenreduktion. Derzeit ist es eher so, dass versucht wird, den Gemeinden mehr Aufgaben zuzuweisen. Aber wenn die Länder jetzt hergeben und den Gemeinden Aufgaben zuteilen, aber nicht das Budget dazu, dann zerfetzt es sie endgültig. Einnahmenseitig können Gemeinden selber nicht viel machen.
Wären Gemeindezusammenlegungen eine Option?
Weber: Das kann ich schon machen und dann wahrscheinlich draufkommen, dass die Wege doch zu weit sein. Die Lösung wird das sein, was seit 20 Jahren ziemlich forciert angegangen wird, nämlich die Gründung von Kooperationen und Verbänden. Und wenn möglich Aufgaben an Land oder Bund abgeben.
Die werden über zusätzliche Kosten auch nicht begeistert sein.
Weber: Das ist das Problem.
Das Buch: Vorarlberger Gemeindewahlen und ihre Besonderheiten
Günther Pallaver, Wolfgang Weber und Marcelo Jenny analysieren 70 Jahre Gemeindewahlen in Vorarlberg.
Die Vorarlberger Gemeindewahlen der Zweiten Republik beleuchten Günther Pallaver, Wolfgang Weber und Marcelo Jenny in ihrem vor Kurzem erschienenen Buch „Kommunalwahlen in Vorarlberg 1950–2020“. Neben den dreien, die als Herausgeber und Autoren fungieren, sind noch Beiträge von Philipp Umek, Johannes Weiler, Andreas Pehr und Carmen Walenta-Bergmann im knapp 350 Seiten starken Werk enthalten.
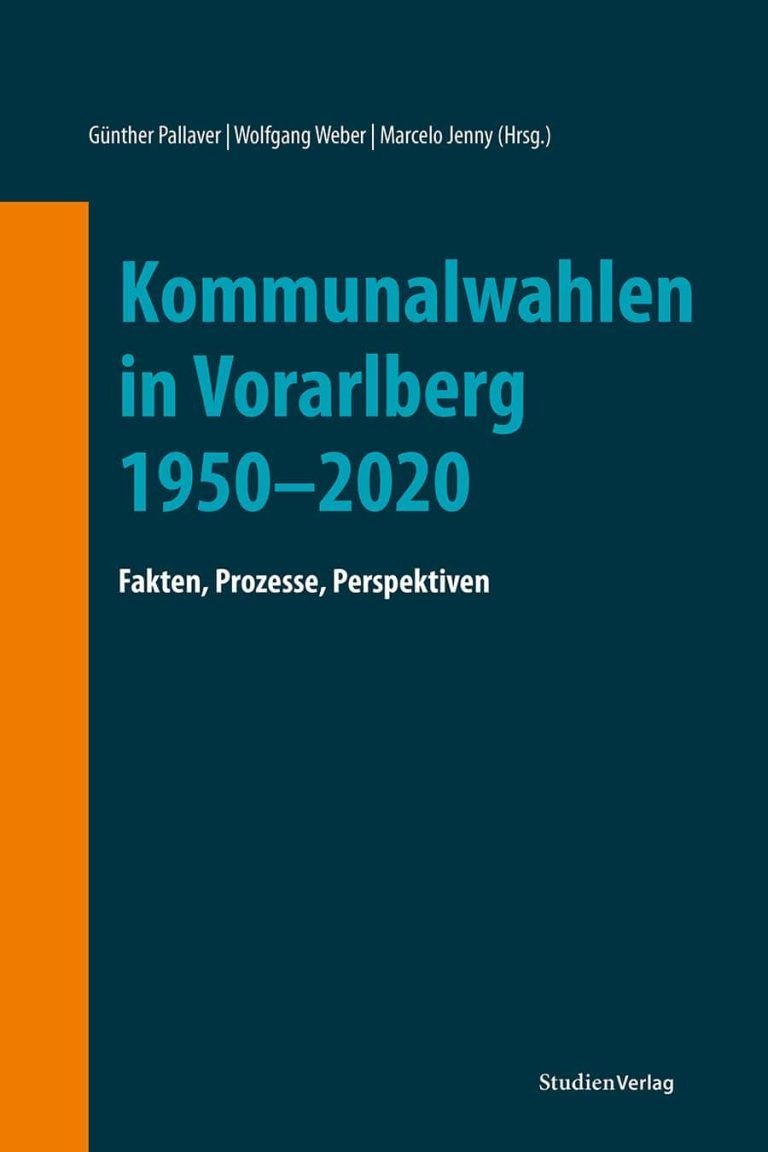
Vorarlberg hat mit 96 die wenigsten Gemeinden aller österreichischen Bundesländer – Wien ist gleichzeitig Gemeinde und Bundesland. Am meisten Menschen leben in Dornbirn, am wenigsten in Dünserberg. Gemeindewahlen finden alle fünf Jahre statt. Bis auf die Wahl 2020, die aufgrund von Corona auf den Herbst verlegt wurde, fanden alle im April oder März statt.
Mehrheitswahl
Eine Besonderheit in Vorarlberg ist die Mehrheitswahl. Dabei werden die Namen von passiv Wahlberechtigten der Gemeinde auf einen leeren Stimmzettel geschrieben. Die Personen mit den meisten Stimmen sind gewählt. Bei der letzten Wahl waren es ein gutes Dutzend (kleine) Gemeinden, die derart abgestimmt haben.
1984 wurde dieses Verfahren vom Verfassungsgerichtshof als nicht zulässig erklärt. Seit 2000 ist es aber nach einer Gesetzesnovelle von 1998 wieder im Einsatz. Bei dieser Reform wurden auch die Direktwahl von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen und das Wahlrecht für EU-Bürgerinnen und -Bürger eingeführt.
Buch und Präsentation
Günther Pallaver, Wolfgang Weber, Marcelo Jenny (Hrsg.): „Kommunalwahlen in Vorarlberg 1950–2020.
Fakten, Prozesse, Perspektiven“. Studienverlag Innsbruck 2024, 342 Seiten, 29.90 Euro.
Präsentation: 27. Februar, 19 Uhr, Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Götzis. Anmeldung erbeten: https://arbogast.at
Detailliert und anschaulich analysieren die Autoren und die Autorin in 14 Beiträgen 70 Jahre Gemeindewahlen in Vorarlberg – beginnend mit einer soziodemographischen Darstellung des Landes und „Kontinuitäten und Brüche“ in diesen 70 Jahren. In der Folge werden einzelne Aspekte thematisiert, darunter die Bürgermeister/in-Direktwahl, Mehrheitswahl oder die geringe Anzahl von Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung in den politischen Gremien.
Dabei kommt es immer wieder mal zu Wiederholungen, die aber nicht stören. Allerdings findet sich auch ein inhaltlicher Widerspruch. So wird mehrmals darauf hingewiesen, dass EU-Bürger/innen nicht Mitglied des Gemeindevorstandes werden können. Das entspricht auch dem Gesetz. Dennoch ist im Buch an anderer Stelle von Nichtösterreicher/innen in Gemeindevorständen die Rede.
Insgesamt ist das Buch aber spannend, informativ und nicht nur für Politikinteressierte äußerst lesenswert.