„Ich habe mich beim Debüt fast ang’schissen“

INTERVIEW. Am 12. Juli wurde im Skimusesum Damüls eine Sonderausstellung eröffnet. Hubertus von Hohenlohe (66) stand als Ehrengast ebenso auf der Bühne wie Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. Nach dem offiziellen Teil nahm sich Von Hohenlohe, der für Mexiko als Exot 6 Mal bei Olympischen Spielen und 16 Mal bei Skiweltmeisterschaften startete, Zeit für die NEUE. Es entwickelte sich ein lockeres Gespräch der besonderen Art.
Als am Samstag vor einer Woche im Damülser Skimuseum anlässlich des 75-Jahrjubiläums von Head eine Sonderausstellung eröffnet wurde, war der offizielle Teil der Veranstaltung schon vorbei, als sich Ehrengast Hubertus Prinz von Hohenlohe, wie der Skiexot und Head-Markenbotschafter offiziell heißt, viel Zeit für ein Interview mit der NEUE nahm. Im privaten Rahmen, selbst der Pressefotograf war schon weg, entwickelte sich ein faszinierendes Gespräch, zu dem sich auch Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber und die schwedische Riesenslalom-Olympiasiegerin Sara Hector gesellten, die im Bregenzerwald, in Au, ihre Wahlheimat gefunden hat. Nach dem Gespräch kam es zu einem privaten Fotoshooting: Dabei schlüpften die unlängst zurückgetretene Elisabeth Kappaurer und Magdalena Egger in einige der Skirennanzüge, die der Liechtensteiner und Mexikaner Von Hohenlohe für seine Starts bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften designte. Und so entwickelte sich im Damülser Skimuseum ein denkwürdiger Nachmittag mit vielen Lachern, Anekdoten und schon jetzt legendären Momenten.
Der Anlass der Sonderausstellung ist 75 Jahre Head. Wer waren in dieser Zeitspanne für dich die größten Sport-Helden?
Hubertus von Hohenlohe: Franz Klammer. Er war mein Idol. Ich war damals in Kitzbühel zuschauen, als er mit einer Hundertstel Vorsprung vor Gustav Thöni gewonnen hat. Ich bin auf der Hausbergkante gestanden und habe gesehen, wie Franz einen Riesenfehler hatte – am Ende war er trotzdem vorn. Als er ins Ziel kam, gab’s beim Jubeln kein Halten mehr. Ich weiß noch, wie ich dachte, das kann doch fast nicht wahr sein, dass er wieder gewonnen hat, aber so war er eben, der Skikaiser: Er war so außergewöhnlich gut, dass er diesen Fehler kompensieren konnte. Franz Klammer hat mich inspiriert, später war dann Bode Miller eine Inspiration für mich. Es gab auch noch andere, wie Maria Höfl-Riesch, Didier Cuche oder Aksel Lund Svindal, aber wenn ich bei einem Namen bleiben soll, dann ist das Franz Klammer: Er ist der Grund, warum ich Skirennfahrer wurde.
Hannes Mayer: Zu dem legendären Rennen in Kitzbühel, als Klammer im Jahr 1975 mit einer Hundertstel Vorsprung gewonnen hat, gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte, die mir Franz mal erzählt hat. Und zwar war er schon beim Siegerinterview, als plötzlich ein Aufschrei durch das Publikum ging, gefolgt von einem Jubel. Klammer dachte sich: „Was haben die denn? Der Thöni ist in der Abfahrt doch nie bei mir dabei, der ist doch bestimmt zwei Sekunden hinten?“ Dann schaute er zur Anzeigetafel und sah erschrocken, dass Thöni nur eine Hundertstel hinten war.
Von Hohenlohe: Das ist ja spannend!
Mayer: Es gibt noch eine Geschichte dazu: Der wirkliche Zeitunterschied betrug drei Tausendstelsekunden, das hat der damalige Mitarbeiter von Zeitnehmer Longines später ausgeplaudert – der Mitarbeiter hieß Sepp Blatter. Die drei Tausendstel waren auf der Strecke zwei Zentimeter.
Von Hohenlohe: Danke für diesen Einblick, das wusste ich nicht. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch. (lacht)
Mayer: Während der tatsächliche Zeitunterschied beim Hahnenkammrennen 1975 als der knappste Zeitunterschied in der Geschichte des Abfahrtssports gilt, stellte Klammer eine Woche davor in Wengen den Rekord für den größten Vorsprung auf, der heute noch gilt: Er war damals 3,54 Sekunden vorn.
Von Hohenlohe: Daran kann ich mich sehr gut erinnern, in Wengen hat er alle in Grund und Boden gefahren, das war episch.

Ich wollte eigentlich die Frage nachschicken, wer für dich die größten Champions des Skisports sind, aber da waren ja schon nur Skirennläufer dabei. Ich frage trotzdem noch mal nach: Wer war denn für dich der Größte unter den Skifahrern?
Von Hohenlohe: Das Emotionale außen vor gelassen kann die Antwort nur Ingemar Stenmark lauten. Ich war in den 1970er-Jahren ein Teenager und habe seine und auch Klammers große Zeit intensiv miterlebt. Stenmark war ein Phänomen, er hat eine Epoche geprägt, so dominiert hat er. Ihm sehr nahe kam dann später Alberto Tomba. Natürlich muss auch der Name Marc Girardelli fallen, und, ich bleibe dabei, Franz Klammer und Bode Miller.
Gegen all diese Größen bist du ja auch angetreten. Du bist tatsächlich der einzige Athlet, der als Aktiver die Entwicklung von den langen Slalomlatten, die deutlich über zwei Meter hatten, bis hin zu den ganz kurzen Carvern mitgemacht hat. Wie viel schwieriger war es früher, mit den langen Latten schnell zu sein?
Von Hohenlohe: Ich musste während meiner Karriere sehr oft die Fahrweise ändern, mit den veränderten Skilängen änderten sich ja auch die Kurssetzungen, gerade, was die Torabstände betraf. Diese Entwicklung konnte ich mitmachen, weil ich immer ein Bewegungstalent war. Ich habe zwar zu wenig trainiert, um richtig gut zu werden, aber ich hatte das Talent, mich auf neue Techniken einzustellen.
Wir kommen im Laufe des Gesprächs darauf zurück, aber man würde dich gewaltig unterschätzen, wenn man deine Leistungen abtun würde. Du warst und bist ein sogenannter Exot, aber in jungen Jahren warst du gut dabei.
Von Hohenlohe: Ich hatte meine Platzierungen im Weltcup, das ist richtig, wie gesagt, ich hatte die Ski schon immer unter Kontrolle. Ich habe die verschiedenen Veränderungen auch immer als Herausforderungen betrachtet, mich weiterzuentwickeln. Schwierig war die Zeit, als wir im Riesentorlauf mit 1,95-Meter-Ski mit einem Radius von 35 Metern fuhren, da habe ich die Ski kaum um die Ecke gebracht. Das war eine mühsame Geschichte. Es ist mir entgegengekommen, als der Radius danach wieder auf 30 Meter reduziert wurde. Im Slalom ist es heute mit den kurzen Carvingski natürlich viel einfacher geworden. Nichtsdestotrotz sind heute die Löcher auf der Piste kurz und tief, da rüttelt es dich durch, früher entstanden auf der Piste aufgrund der langen Ski lange Rillen, in denen der Ski dann stabil dringelegen ist. Außerdem sind die Pisten heutzutage bei den großen Rennen komplett vereist, wenn das Eis bricht, rattern die Ski noch mehr. Und ein Carvingski, der so richtig rattert, ist viel schwieriger zu bändigen als damals in den 1980ern die langen Latten in den gleichmäßig tiefen, schönen Rillen. Das kann die Sara sicher bestätigen? Anmerkung: Seit einigen Minuten verfolgt die schwedische RTL-Olympiasiegerin Sara Hector das Gespräch aufmerksam.
Sara Hector: Ich bin nie mit so langen Ski gefahren. Mit dem richtigen Timing bleibst du auch bei den tiefen Löchern auf Zug.
Von Hohenlohe: Schon, aber es ist irrsinnig schwierig, aus diesen tiefen Dingern wieder rauszukommen.
Hector: Das kann sein, Hubertus, aber mir fehlt der Vergleich. Ich bin niemals mit Zwei-Meter-Ski gefahren.
Rainer Salzgeber: (Auch er hat sich zur Runde dazugesellt) Ich bin noch mit sehr langen Ski gefahren, mit niedrigen Startnummern ist es heute viel einfacher.
Von Hohenlohe: Klar, mit einer tiefen Nummer ist es richtig geil, heute zu fahren.

Ich finde das ja sehr spannend: Allgemein sagen alle Experten, dass es früher viel schwieriger war, die langen Latten zu kontrollieren – was aber offensichtlich nur aus Perspektive der Topläufer gilt?
Von Hohenlohe: So lässt es sich zusammenfassen. Mit einer schlechten Startnummer wartet heute auf einen das Chaos auf der Strecke, da kommst du nicht auf Zug, früher war auch noch mehr Platz zwischen den Toren, heute sind die Tore eng gesteckt. Aber im Kampf um die Hundertstelsekunden war es früher sicher viel härter, schnell zu sein. Deshalb kann man ja die Leistungen von Leuten wie Stenmark oder Klammer gar nicht hoch genug einschätzen, die haben mit Ski von über zwei Metern wahre Wunder vollbracht.
Zumal ja auch die Pistenpräparierung mit dem Kunstschnee und den glattgewalzten Pisten völlig anders ist. Bis 1980 wurde nur auf Naturschnee gefahren.
Von Hohenlohe: Mir kommt vor, dass es früher in der Abfahrt viel schwieriger war, weil die Pisten von Haus aus viel unruhiger waren. Wenn du in Kitzbühel im Ziel angekommen bist, hattest du keine Kraft mehr, weil es so geruckelt hat. In Wengen zu fahren war angenehmer, die Lauberhornabfahrt war glatter, da hat dich dann aber die Lauflänge fertiggemacht. Und über Bormio brauchen wir gar nicht zu reden, da fallen dir die Plomben raus. (lacht)
Bist du lieber mit den alten unflexiblen Bambusstangen Slalom gefahren oder mit den Kippstangen?
Von Hohenlohe: Ganz klar den Kippstangen, mir gefällt der Bewegungsablauf viel besser.
Bei den Spielen 1980 in Lake Placid wurde zum ersten Mal mit Plastikstangen gefahren, die ähnlich flexibel waren wie unmittelbar danach die Kippstangen, dadurch konnten die Läufer viel direkter fahren – die Bambusstangen musste man ja umkurven. Heute wäre es undenkbar, dass bei Olympischen Spielen so eine elementare Änderung vorgenommen würde, zumal es auch das erste Kunstschneerennen war.
Von Hohenlohe: Das kann nicht sein, dass schon 1980 Plastikstangen eingeführt wurden.
Mayer: Doch, doch, das stimmt. Stenmark hatte das geahnt und sein Training auf die flexiblen Torstangen ausgerichtet, deshalb startete er 1979/80, für seine Verhältnisse, etwas holprig in die Slalomsaison. Der Vorarlberger Christian Orlainsky wurde in Lake Placid sogar ein Opfer der neuen Plastikstangen, die waren nämlich nicht fest genug im Boden verankert, viele Stangen lockerten sich, rutschten den Hang hinunter, was die Läufer noch nicht gewohnt waren. Orlainsky war im ersten Durchgang auf dem Weg unter die Top Drei, als eine Stange in Richtung seiner Lauflinie rutschte und er daraufhin stürzte. Im ersten Slalom nach Lake Placid, dem Torlauf von Waterville, wurde dann bereits mit echten Kippstangen gefahren, das Rennen gewann Stenmark, der schon ein Jahr zuvor die Kippstangen für die FIS getestet hatte.
Von Hohenlohe: Das wäre mir komplett neu. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass die Kippstangen erst später kamen.
Salzgeber: Ich kann den genauen Zeitpunkt nicht beschwören, aber wenn Hannes Mayer sagt, dass die Kippstangen 1980 eingeführt wurden, dann wird das so gewesen sein. (lacht)
Von Hohenlohe: Den Eindruck habe ich auch. (lacht) Hannes, du erzählst das mit so einer Klarheit, dass es so gewesen sein muss. Aber Robert Zoller war doch einer, der von der Einführung der Kippstangen so profitiert hat bei der WM in Bormio 1985?
Mayer: Das ist natürlich richtig, er gewann in Bormio vor allem deswegen Bronze, weil die WM in dieses kurze Zeitfenster fiel, in dem er einen Technikvorsprung hatte. Zoller kippte die Stangen mit den Knie um und nicht mit den Händen. Das hat aber nichts mit dem Zeitpunkt der Kippstangen-Einführung zu tun.
Von Hohenlohe: Zoller hat immer die geradeste Linie gewählt. Ganz was anderes: Rainer, erinnerst du dich, wir haben 1991 oder 1992 vor einem Rennen in Schladming einen Kaffee getrunken.
Salzgeber: Davor? Vor dem Rennen?
Von Hohenlohe: Ja, wir sind im Café zusammengesessen. Es kann aber sein, dass das doch an einem Trainingstag war.
Salzgeber: Stimmt, da war was, ich erinnere mich, aber das war ganz sicher nicht vor einem Weltcuprennen.

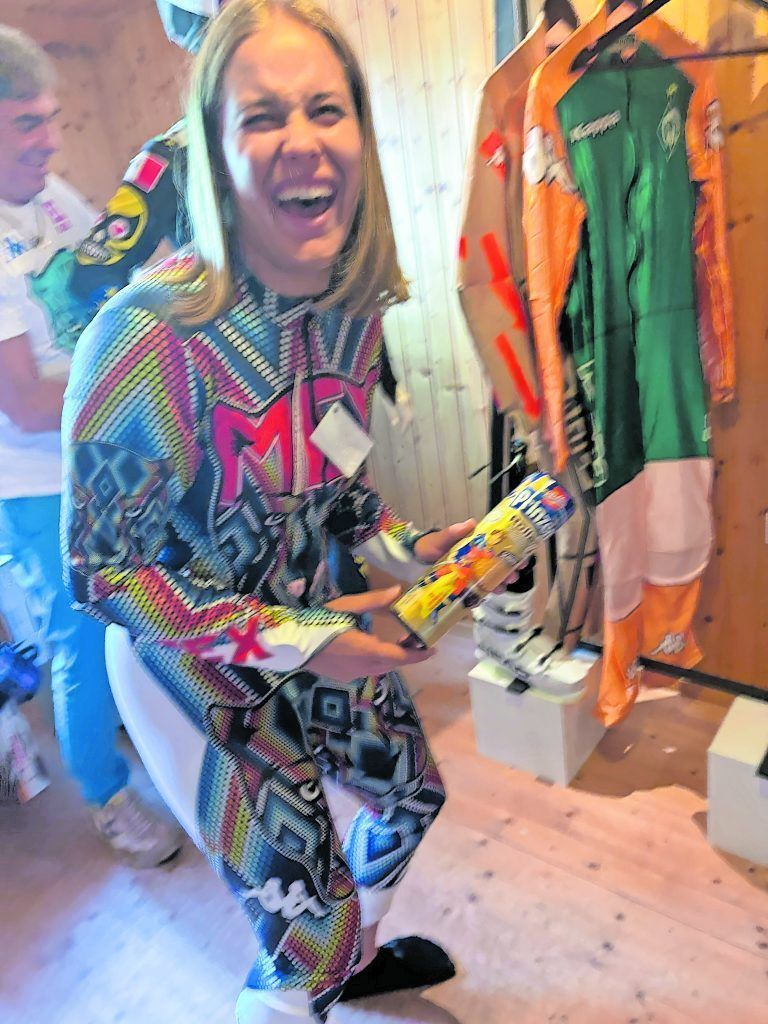
Nach dem sehr weiten Abstecher nun eine ganz andere Frage: Haben dich die Superstars akzeptiert oder doch eher nur belächelt?
Von Hohenlohe: Die haben mich schon akzeptiert. Ich habe ja nicht in ihrem Teich gefischt. Ich war einer, der Farbe reingebracht hat, der den Menschen am Pistenrand und vor den Fernsehern gezeigt hat, dass auch normale Leute ohne hochprofessionelles Training da runterfahren konnten. Ich glaube, die meisten haben es cool gefunden, was ich gemacht habe. Ich war mit vielen befreundet, wie Tomba, Miller oder Girardelli.
Am Anfang deiner Karriere, um auf die Anmerkung von vorhin zurückzukommen, hast du starke Ergebnisse eingefahren im Weltcup. Stand zu Beginn deiner Karriere der sportliche Aspekt mehr im Vordergrund als später und freilich jetzt mit über 60 Jahren?
Von Hohenlohe: Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich es anfangs in der Kombination recht konstant unter die ersten Zehn gebracht habe. In Madonna wurde ich Fünfter, in Wengen Siebter. Aber es war mir immer bewusst, dass ich es nicht in die Weltspitze schaffen werde, weil ich einfach zu spät mit dem Skifahren begonnen habe. Als mir vor Sarajevo 1984 nur eine Zehntelsekunde fehlte, um ins liechtensteinische Team aufgenommen zu werden, habe ich mich aber schon etwas geärgert, ich dachte mir: Wenn ich mehr trainiert hätte, wäre ich zwei, drei Sekunden schneller gewesen. Da war mir dann klar: So schlecht bin ich gar nicht. Aber es war nie meine Absicht, mein Leben nur auf den Sport auszurichten und quasi Tag und Nacht zu trainieren, es ist ja nicht meins, nur eine Sache konsequent zu verfolgen, sondern ich wollte immer vieles machen, ich hatte und habe viele Interessen.
Salzgeber: (Er hat sich zwischenzeitlich mit Ariane Rädler unterhalten) Ich verabschiede mich, Anita hat mir gerade noch eine Einkaufsliste geschickt. (lacht)
Von Hohenlohe: Wenn ich mal wieder in Liechtenstein bin, komme ich bei euch vorbei.
Salzgeber: Gerne! Euch noch viel Spaß beim Gespräch, ich freu’ mich schon drauf, das Interview zu lesen.
Wenn wir gerade bei deinen anderen Interessen sind: Stimmt die Anekdote eigentlich, dass du mal ein Lied produzieren wolltest, zu dem John Travolta tanzt?
Von Hohenlohe: Nein, die stimmt nicht. (lacht)
Und wenn ich dir jetzt ein Zitat von dir dazu vorlesen würde?
Von Hohenlohe: Auch dann stimmt es nicht. (lacht) Nein, was ich jetzt mache, ist, ein Musikvideo mit einer mexikanischen Mariachi zu produzieren, also mit einer typisch mexikanischen Musikformation. Das Video drehen wir in den kommenden Tagen in Mexiko. Es ist ein Lied, das mehr oder weniger meine Karriere als Skirennläufer in einen Sound verpackt. Der Sound ist eine Mischung aus Rap, Hip-Hop und Mariachi-Sound. Das wird dann ab September auch hier im Skimuseum Damüls zu sehen sein. Aber John Travolta? Nein, es kann schon sein, dass ich da mal was vor mich hin geplappert habe, aber das war nicht ernst gemeint.


Was würdest du als dein bestes Rennen bezeichnen?
Von Hohenlohe: Die Olympiaabfahrt von Sarajevo 1984. Ich war damals nur etwa fünf Sekunden langsamer als der Olympiasieger Bill Johnson. Ich stand da sehr unter Druck, ganz Mexiko hat zugeschaut, weil es das erste Mal war, dass Mexiko einen Skifahrer am Start hatte. Damals gab es ja noch nicht so viele Zerstreuungen wie Netflix oder Amazon, da haben wirklich sehr viele Menschen das Rennen geschaut. Ich musste daher performen, damit die Mexikaner stolz auf mich waren. Das Rennen hat meine weitere Karriere beeinflusst. Ich musste beweisen, dass ich gut genug bin, um mich bei den Großereignissen starten zu lassen. Ich weiß noch, dass ich geil runtergezogen bin, wobei die Strecke damals nicht so viele Kurven hatte wie üblich.
Mayer: Die Strecke wurde damals als Autobahn bezeichnet, Franz Klammer nannte Sieger Bill Johnson einen Nasenbohrer.
Von Hohenlohe: Ja genau! In Kitzbühel war ich mal nur acht Sekunden hinter Klammer.
Die Anekdote stimmt aber, dass Werner Grissmann mit dir vor deinem ersten Abfahrtsrennen um fünf Champagner-Flaschen wettete, dass du mindestens zehn Sekunden hinter ihm liegst?
Von Hohenlohe: Die stimmt. Ich habe die Wette gewonnen, ich habe nur etwa neun Sekunden verloren. Ich war im Training 16, 17 Sekunden hinten, dann 13 und 14 Sekunden – aber da habe ich nicht alle Karten aufgedeckt. (lacht) Ich habe geblufft. (lacht herzlich)
Mayer: Grissmann war ja der Zwischenzeitweltmeister, wahrscheinlich hast du im Rennen im unteren Teil aufgeholt. (lacht)
Von Hohenlohe: (lacht) Wahrscheinlich war es so. Aber Scherz beiseite, ich habe mich damals in Aprica wirklich fast ang’schissen. Es war mein erstes Weltcuprennen, und dann stürzt noch Roland Collombin schwer. Ich habe mich im Training wirklich nicht getraut, voll zu fahren, darum hat sich Grissmann wohl zu dieser Wette hinreißen lassen.
Grissmann galt als der letzte Clown im Skiweltcup. Früher wurde schon viel mehr gefeiert als heute?
Von Hohenlohe: Es war schon lockerer, aber halt auch nicht jeder. Stenmark hat nach dem Abschwingen im Ziel wahrscheinlich schon wieder ans nächste Training gedacht, aber Tomba hat natürlich gefeiert. Auch später waren noch lockere Typen dabei, die gibt es auch heute noch vereinzelt, nur, früher waren recht viele Läufer locker drauf. Die Teilnehmer von den hinteren Nationen sind nach wie vor lustig. Ich bin eng befreundet mit dem Typen aus Bosnien oder den Läufern aus Luxemburg, Dänemark, East Timor – jetzt ist sogar ein Läufer aus Saudi-Arabien dabei. Wir Skiexoten bestreiten in Toblach in Südtirol die mexikanischen Meisterschaften – und feiern dort immer wirklich geile Partys. Da geht’s richtig ab.
Du hast nicht nur die vielen technischen Entwicklungen des Skisports mitgemacht, sondern als sechsfacher Olympiateilnehmer auch die Entwicklung der Spiele – von der Einfachheit in Sarajevo 1984 bis hin zu den gigantischen Spielen in Sotschi 2014. Was lag dir mehr: die familiäre Atmosphäre oder die Wucht in Sotschi?
Von Hohenlohe: Ich meine, dass eine Inflation eingesetzt hat, es gibt zu viele Bewerbe. In Sarajevo gab es keine 40 Entscheidungen, inzwischen sind es über 100. Als ich 2018 in Südkorea als Gast im olympischen Dorf war, ist gefühlt jeder Athlet mit einer Medaille rumgelaufen. Es gibt so viele Staffelbewerbe und Mixed-Formate, dann hat man im Eisschnelllauf den Massenstart und im Biathlon die Verfolgung eingeführt, und so weiter und so fort. Wenn einer in Sarajevo eine Medaille hatte, haben alle gestaunt, damals gab es ja noch nicht mal die alpine Kombination, es gab bei den Alpinen nur drei Disziplinen. Der Charakter der Spiele hat sich besonders seit 2018 komplett verändert. In Sotschi 2014 noch hatte an jedem Abend eine Band einen Auftritt, der TV-Sender ABC hat Größen wie John Denver oder Crosby, Stills and Nash ins olympische Dorf gebracht. Da waren alle zusammen, inzwischen ist doch fast ein jeder Athlet nur mehr auf Social Media – es wird nicht mehr mit dem anderen geredet, der neben einem sitzt, sondern nur noch aufs Handy geschaut. Social Media hat viel kaputtgemacht. Früher hatten wir Spielhallen, wo wir alle gemeinsam Tischfußball oder Pingpong gespielt haben, das ist immer mehr verschwunden. In Lillehammer waren fantastische Spiele, weil die Norweger so ein cooles Volk sind, alle sind gut drauf, das waren echte Winterspiele. Es hatte minus 21 Grad, Schnee ohne Ende – das war ein Winterwonderland wie aus dem Märchenbuch.
Bleibt noch: Du bist in Vorarlberg in der Mehrerau in ein katholisches Internat gegangen. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt?
Von Hohenlohe: Es ist schon hart, als Zehn- oder Elfjähriger irgendwohin gesteckt zu werden, damit man sich nicht so um einen kümmern muss. Aber ich habe in der Mehrerau Halt gefunden, es hat mich geprägt, dass nicht nur Schlaraffenland angesagt war. Mein Vater hat ja in Spanien den Marbella-Club gegründet, das war Luxus pur. In der Mehrerau herrschte das andere Extrem, es war sehr karg, der Sport war die einzige Freude, ich habe Fußball gespielt, war sogar im Handball Tormann der Vorarlberger Auswahl, Ski gefahren bin ich da gar nicht so viel.
Mayer: Das war’s, wir sind am Ende des Gesprächs.
Von Hohenlohe: Es war wirklich lustig, mach’ was Geiles draus. (lacht)