„Von einer Minute auf die andere war alles anders“

Seit dem Schlaganfall ihres Mannes lebt Monika Novak zwischen Pflege, Bürokratie und kleinen Momenten des Glücks. Sie und ihr Mann Klaus aus Bregenz zeigen, wie viel Stärke in leisen Gesten steckt.
Es war ein Montagabend, als Monika Novak den Satz hörte, der ihr Leben veränderte. Ihr Mann Klaus war gerade in die Küche gegangen, als er rief: „Schatz, hilf mir mal!“ Ein Ruf, der ihr bis heute im Ohr geblieben ist. „Ich wusste sofort, wie spät es ist“, sagt sie. „Klaus lag auf der Eckbank, die rechte Hand hing schlaff, der Fuß gehorchte nicht mehr, die Sprache verwaschen. Da habe ich gewusst: das ist ein Schlaganfall.“ Trotzdem handelte sie – wie sie heute sagt – „völlig irrational“. Statt die Rettung zu rufen, griff sie zuerst zum Handy und wählte die Nummer der Tochter. „Man funktioniert in so einem Moment nicht logisch. Man ist in Panik.“
Schwere Hirnstammblutung
Klaus Novak überlebte eine schwere Hirnstammblutung, vier mal sieben Zentimeter groß. Drei Wochen lang lag er im künstlichen Tiefschlaf, mitten in der Corona-Zeit, ohne Besuchserlaubnis. „Das war das Schlimmste“, sagt Monika leise. „Zwei Wochen lang durfte niemand hinein. Ich wusste nicht, ob er mich jemals wieder erkennt.“ Danach folgten Wochen in der Reha in Rankweil. Zuerst ohne Sprache, ohne Bewegung, ohne Möglichkeit, sich mitzuteilen. „Jeden Tag wollte er uns etwas sagen, aber wir sind nicht draufgekommen“, erinnert sie sich. Dann, ganz langsam, kamen die Worte zurück und mit ihnen die Hoffnung. „Dass er geistig voll da ist, war das größte Geschenk.“

Wenn Klaus heute spricht, braucht er Zeit. Die Worte kommen mühsam, Satz für Satz, manchmal nur einzelne Wörter. Aber jeder Blick, jede Geste zeigt, dass er genau weiß, was er sagen will. „Ich hab alles noch im Kopf“, sagt er schließlich, kämpft sich durch die Silben. „Aber … die rechte Seite … macht … nicht mehr mit.“ Dann lächelt er. Es ist kein resigniertes, sondern ein trotziges Lächeln.
Ein neues Leben
Heute, fünf Jahre später, lebt Klaus Novak in einem Pflegeheim im Vorderwald. Rechtsseitig gelähmt, aber geistig klar. Er malt, hört Musik, besucht Museen, telefoniert jeden Abend mit seiner Frau. „Klaus liebt Musik, von Phil Collins über Tina Turner bis Bryan Adams. Musik hält ihn jung.“ „Wenn Musik läuft … geht’s mir gut“, bringt Klaus mühsam hervor. Monika legt ihm sanft die Hand auf die Schulter. „Das ist besser als jede Medizin“, sagt sie. Sie besucht ihn zwei- bis dreimal die Woche und holt ihn regelmäßig heim. „Er ist zu jung für ein Pflegeheim“, sagt sie. „Ich möchte, dass er so oft wie möglich rauskommt.“
Der Alltag hat sich komplett verändert. Monika, selbst nach einer Operation stark eingeschränkt, musste lernen, neu zu leben. „Ich habe gelernt, alles zu organisieren, zu kämpfen, Anträge zu schreiben, Hilfe zu suchen. Für mich und für ihn.“
Liebe, Bürokratie und Geduld. Das Leben mit einer Behinderung sei nicht nur körperlich, sondern auch bürokratisch eine Herausforderung. „Ich musste für den behindertengerechten Umbau unseres Autos vier verschiedene Förderanträge stellen, obwohl alle Stellen am selben Tisch sitzen: Land, Sozialministerium, Krankenkasse, Pensionsversicherung. Jeder will andere Unterlagen. Warum kann man das nicht zentral machen?“

Derzeit kämpft sie um die Bewilligung einer motorisierten Schiebehilfe für den Rollstuhl. „Ich schaffe die Steigungen nicht mehr allein“, sagt sie. 5500 Euro kostet das Gerät, die Genehmigung steht noch aus. „Ich schreibe Begründungen, lege Gutachten bei, und dann warte ich. Man weiß nie, ob etwas bewilligt wird.“
Trotz allem verliert sie nicht den Mut. „Ich habe im ersten Jahr viele Tränen vergossen. Aber irgendwann habe ich verstanden: Man darf sich nicht aufgeben. Ich habe Gesprächstherapie gemacht, das hat mir sehr geholfen.“ Heute sagt sie mit Überzeugung: „Man muss akzeptieren, dass es Grenzen gibt und das Beste daraus machen.“
Kleine Schritte
Klaus Novak hat das Malen für sich entdeckt. Mit kräftigen Farben, manchmal mit Bleistift. „Er malt gern Natur, Bäume, Berge – Menschen weniger“, sagt Monika. „Das ist schwieriger. Aber wenn er malt, weiß ich, es geht ihm gut.“
Über die Kunst, sagt sie, habe er wieder Zugang zu sich selbst gefunden. „Er kann sich ausdrücken, auch wenn die Worte manchmal fehlen.“ In der Reha lernte er, mit der linken Hand zu malen, probierte Farben, Formen, Techniken. „Er hat ein unglaubliches Auge fürs Detail.“


Digital verbunden
Die Technik hilft, in Verbindung zu bleiben. Jeden Abend telefonieren sie per FaceTime, ein Ritual, das geblieben ist. „In der Corona-Zeit war das die einzige Möglichkeit, ihn zu sehen“, erinnert sich Monika. „Ich habe ihm Fotos geschickt, jeden Tag. So war ich wenigstens ein bisschen bei ihm.“
Wenn sie heute verreist, nimmt sie ihn digital mit. Auf ihrer Reise mit der Hurtigruten, die sie eigentlich gemeinsam machen wollten, schickte sie ihm täglich Bilder und Videos. „Er hat mitverfolgt, wo ich bin. Das hat ihm gefallen. Und mir hat es geholfen, das schlechte Gewissen loszulassen.“

Gutes Leben
Monika und Klaus Novak haben gelernt, dass Liebe nicht nur Zuneigung bedeutet, sondern Organisation, Geduld und Durchhaltevermögen. „Früher hat er viel für mich gemacht, jetzt bin ich für ihn da“, sagt sie.
Sie haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt: ihre eigene Operation, seine Krankheit, die Isolation während der Pandemie. „Wir haben schon vor dem Schlaganfall viel durchgestanden. Das hat uns stark gemacht.“
Trotz aller Einschränkungen bleibt das Leben der beiden erfüllt. Sie gehen gemeinsam ins Museum, feiern mit der Familie, lachen viel. Und sie wissen: „Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Es geht immer weiter, nur anders“, sagt Monika.

Die Rote Schleife
Mehrfach genutzt.
Die rote Awareness-Schleife ist international vor allem als Symbol für den Kampf gegen HIV und AIDS bekannt. Inzwischen wird sie aber auch zunehmend für andere Themen der Herz- und Gefäßgesundheit verwendet, etwa für das Bewusstsein rund um den Schlaganfall. Die Farbe Rot steht dabei für Durchblutung, Lebensenergie und Dringlichkeit, denn beim Schlaganfall zählt jede Minute.
Der Welt-Schlaganfall-Tag wird jedes Jahr am 29. Oktober begangen und wurde 2006 von der World Stroke Organization (WSO) ins Leben gerufen. Ziel ist es, weltweit Aufmerksamkeit auf Schlaganfall als weit verbreitetes Gesundheitsproblem zu lenken: eine Krankheit, die häufiger schwere Folgen hat als viele andere große Erkrankungen. Die rote Schleife wird in diesem Zusammenhang zunehmend als Symbol verwendet.
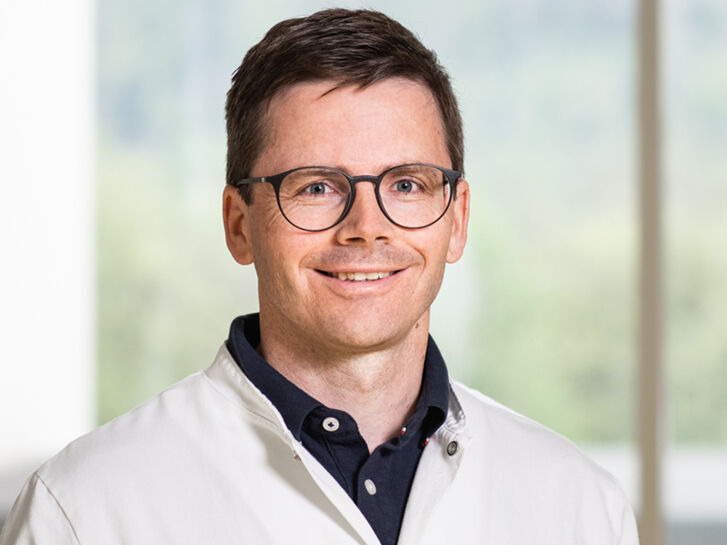
3 Fragen an … Prim. Dr. Philipp Werner, Abteilungsleiter Neurologie, LKH Feldkirch/Rankweil.
1. Wie können Laien die Symptome eines Schlaganfalls zuverlässig erkennen und warum ist es so entscheidend, schon bei den ersten Anzeichen sofort zu handeln?
Werner: Laien können einen akuten Schlaganfall an einer plötzlichen (!), also von einer auf die andere Sekunde aufgetretenen körperlichen Ausfallserscheinung erkennen (z.B. Lähmung mit/ohne Gefühlsstörung im Gesicht oder an einer Körperhälfte, Sprachstörung, Sehstörung etc.).
Ein gutes Tool stellt hierbei der sog. FAST-Test dar:
- Face (Gesicht): Hängt ein Mundwinkel schief?
- Arm: Kann die Person beide Arme vor dem Körper in die Höhe heben? Sinkt/fällt einer der Arme herunter?
- Speech (Sprache): Spricht die Person undeutlich („wir betrunken“)? Bringt die betroffene Person die Wörter nicht mehr über die Lippen?
- Time (Zeit): Sofort den Notruf (144 oder 112) wählen! Merken, wann genau die Ausfallserscheinungen begonnen haben!
2. Welche Risikofaktoren sehen Sie in Ihrer täglichen Praxis am häufigsten und was kann jeder Einzelne konkret tun, um sein Schlaganfallrisiko zu senken?
Werner: Risikofaktoren sind der Bluthochdruck, hohes (LDL-)Cholesterin, Rauchen, Alkoholkonsum und die Zuckerkrankheit.
Konkrete Maßnahmen zur Senkung des Risikos sind:
- Nicht rauchen.
- Alkohol vermeiden.
- Blutdruck regelmäßig messen und dokumentieren (Wichtig: Den Blutdruck-Zielwert ärztlich festsetzen lassen!).
- 1x im Jahr im Blut das LDL-Cholesterin bestimmen (Wichtig: den LDL-Cholesterin-Zielwert ärztlich festsetzen lassen).
- Gelegentlich den Blutzucker-Langzeitwert („HbA1c“) im Blut bestimmen lassen.
3. Wie gut sind die Chancen auf ein selbstständiges Leben nach einem Schlaganfall heute und welche Fortschritte gibt es bei der Rehabilitation in den letzten Jahren?
Werner: Wenn Betroffene bei plötzlichem (!) Auftreten eines der oben genannten Symptome sofort die Rettung alarmieren, werden Sie je nach Gegebenheit schnell in ein Schlaganfallzentrum – in diesem Fall die Stroke Unit am LKH Feldkirch – gebracht. Dort können Dank der hohen fachlichen Expertise und technischen Ausstattung sämtliche modernen Schlaganfall-Therapien bis hin zum sogenannten „Hirnkatheter“ durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden haben in Vorarlberg in den letzten 15 Jahren dazu geführt, dass sich die Zahl der schweren Pflegefälle erfreulicherweise mehr als halbiert hat. Die Chance, nach einem Schlaganfall wieder ein vollkommen selbstständiges Leben zu führen, liegt bei ca. 30-40 Prozent. Dies hängt allerdings davon ab, wie schwer die Ausfälle zu Beginn sind und wie schnell behandelt wird/wurde – nach dem Motto „Time is Brain“ (Zeit ist Hirn)! Die in den ersten Tagen nach einem Schlaganfall notwendigen neurologischen Physio- und Ergotherapien sowie logopädischen Behandlungen im Sinne der Frührehabilitation tragen viel zur rascheren Genesung bei. In Vorarlberg stehen allen Betroffenen glücklicherweise exzellente stationäre und ambulante Nachsorgeeinrichtungen zur Verfügung (z.B. SMO Neurologische Rehabilitation). Wichtig sind regelmäßige Kampagnen zum Thema Schlaganfall. Denn diese erhöhen die Wachsamkeit der Bevölkerung in Bezug auf die Schlaganfall-Risikofaktoren, aber auch die Schlaganfall-Symptome. Dadurch lassen sich eine relevante Zahl an Schlaganfällen schon primär vermeiden.