Alfried Längle – Vom Mut, auf sein inneres Ich zu hören

Alfried Längle (74) zählt zu den wohl bekanntesten Personen in der Welt der Psychotherapie und Existenzanalyse. Im Gespräch mit der NEUE am Sonntag begibt sich der gebürtige Götzner auf Sinnsuche. Und streift dabei Themen wie Arbeit, Künstliche Intelligenz, Führerfiguren, Geschlechterrollen oder seine Professur in Moskau.
NEUE am Sonntag: Erzählen Sie uns bitte ein wenig über Ihren Werdegang – und insbesondere Ihre Zeit mit Viktor Frankl.
Alfried Längle: Ich bin in Götzis geboren und aufgewachsen, habe die Schule in Feldkirch besucht, dann in Innsbruck Medizin und Psychologie studiert. Aus Interesse für Sprachen habe ich ein Jahr in Rom und eines in Toulouse verbracht. Anschließend bin ich nach Wien gegangen, um dort beide Studien abzuschließen. In dieser Zeit hörte ich Viktor Frankl regelmäßig – er hielt jeden Mittwoch Vorlesungen, der Hörsaal war immer voll. Meine damalige Freundin, heute meine Frau, begleitete mich oft, und wir diskutierten danach stundenlang. Ich kannte Frankl bereits aus Büchern. Doch durch die Vorlesungen und unsere eigenen Gespräche bin ich intensiver in die Logotherapie eingetaucht. Nachdem mein ursprünglicher Wunsch, in die Hirnforschung zu gehen, gescheitert war, hielt ich bei einem Kongress in den USA einen Vortrag über Logotherapie – Frankl wurde darauf aufmerksam, lud mich ein, an seinen Vorlesungen mitzuwirken, und bat mich schließlich, an der Gründung eines Instituts in Wien teilzunehmen. Heute sind wir die weltweit größte Organisation für existenzielle Psychotherapie.
NEUE am Sonntag: Wie würden Sie Viktor Frankl als Mensch in wenigen Worten beschreiben?
Längle: Er war hochintelligent, geistesgegenwärtig, humorvoll, ein brillanter Redner und tief in der Philosophie wie in der Psychiatrie verwurzelt. Aus dieser Kombination entwickelte er die Logotherapie – philosophisch begründet und medizinisch anwendbar.

NEUE am Sonntag: Laut Ihres Lebenslaufs sind Sie nach wie vor Professor in Moskau. Hat sich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Ihre Tätigkeit und Ihre Sicht auf das Land verändert?
Längle: Mein Bild von Russland selbst hat sich kaum verändert. Ich unterscheide zwischen Politik und Menschen. Ich arbeite mit Kolleginnen, Studenten und Therapeutinnen zusammen, die sehr betroffen sind, sich schämen, gegen den Krieg sind. Doch die Universität reagiert nicht mehr auf meine Mails. Vielleicht bin ich dort nicht mehr erwünscht. Ich tue alles, um dort weiterhin zu lehren – denn es geht um Themen wie Persönlichkeit, Verantwortung und Freiheit. Vielleicht bin ich genau aus diesem Grund als ausländischer Professor nicht mehr erwünscht.
NEUE am Sonntag: Sie sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Vater von vier Kindern. Wie bringen Sie das unter einen Hut?
Längle: Mit Einschnitten, mit Verzicht – und auch mit Leid. Meine Frau und meine Kinder haben unter meiner beruflichen Abwesenheit gelitten. Ich habe versucht, das zu kompensieren, indem ich, wenn ich daheim war, ganz da war. Mit Qualität, mit echtem Engagement. Dennoch sagen meine Kinder heute: Du hast uns oft gefehlt. Meine Frau hat es mitgetragen und unterstützt – nicht wegen des Geldes, sondern weil sie gespürt hat, dass es um etwas Größeres ging. Für andere. Aber auch für mich selbst. Ich lebe in dieser Aufgabe.

NEUE am Sonntag: Wie stark definieren Sie sich über Ihre Arbeit?
Längle: Sehr. Ich gehe in meiner Arbeit auf, sie erfüllt mich, ich lerne ständig dazu. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Kreislauf der Anregung. Ich definiere mich nicht nur über die Arbeit. Auch Familie, Freundschaften, Natur, Kunst oder Literatur sind mir wichtig. Ich halte es mit Lao Tse: „Tu, was du liebst, und du wirst nie wieder arbeiten müssen.“
NEUE am Sonntag: In Ihrem Vortrag im Bildungshaus St. Arbogast, gemeinsam mit Marianne Grobner, wurde der Sinn von Arbeit hinterfragt. Wie gelingt es Unternehmen und Führungskräften, Sinn und Motivation zu vermitteln?
Längle: Der wichtigste Punkt ist: Sie müssen selbst überzeugt sein. Wenn sie brennen, steckt das an. Wer authentisch ist, überzeugt. Begeisterung, Überzeugung und persönliche Ausstrahlung motivieren mehr als jedes Handbuch. Das ist das „Gewürz“ gelungener Führung. Die Mitarbeitenden merken, ob jemand lebt, was er sagt.

NEUE am Sonntag: Trotzdem gibt es Berufe, die einen besseren oder schlechteren Ruf haben. Wie stehen Sie zu Kategorisierungen, vielleicht auch aus Geschlechterperspektive?
Längle: Diese Kategorien stammen aus einer vergangenen Zeit. Heute kann jeder Mensch jeden Beruf ausüben, unabhängig vom Geschlecht. Auch Männer können pflegen – das ist keine Frage des Genpools, sondern der Eignung. Diese Bewusstseinsänderung benötigt Zeit – wie einst bei der Akzeptanz von Homosexualität. Aber sie geschieht.
NEUE am Sonntag: Inwiefern ist hier die Wissenschaft, die Politik oder auch die Geisteswissenschaft gefragt, diese Stereotype zu brechen?
Längle: Es braucht den wissenschaftlichen und politischen Diskurs. Und es braucht die sozialarbeiterische Tätigkeit, um solche Stereotype zu verändern. Gesellschaftliche Prozesse gehen langsam und jeder Einzelne ist aufgerufen, seine Position auch zu vertreten und einzubringen und den anderen zuzuhören, um den Horizont zu erweitern. Und da sind die Geisteswissenschaften aufgerufen, auch die Forschung, die klar zeigt, Männer können auch gut Pflege leisten, nicht nur Frauen.
NEUE am Sonntag: Welche Chancen und Risiken sehen Sie in der aktuell omnipräsenten Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz?
Längle: Die KI ist auf der einen Seite ein Segen, weil sie in der Medizin, in der Psychologie, in der Forschung und unzähligen Bereichen Quantensprünge mit sich bringt. Sie ist auch eine große Erleichterung in der administrativen Versorgung. Da kann sie uns viel Arbeit abnehmen und uns mehr Freiraum geben. Aber sie wird natürlich auch Arbeitsplätze vernichten. Die KI nimmt das Eine ab, ermöglicht und erweitert das Andere. Sie muss aber auch bedient und vor allem kontrolliert werden. Und hier braucht es den Menschen. Vielleicht schafft sie auch Freiräume für Tätigkeiten, die vorher aufgrund von Zeitmangel leiden mussten – also im Idealfall auch mehr Platz für Menschlichkeit.
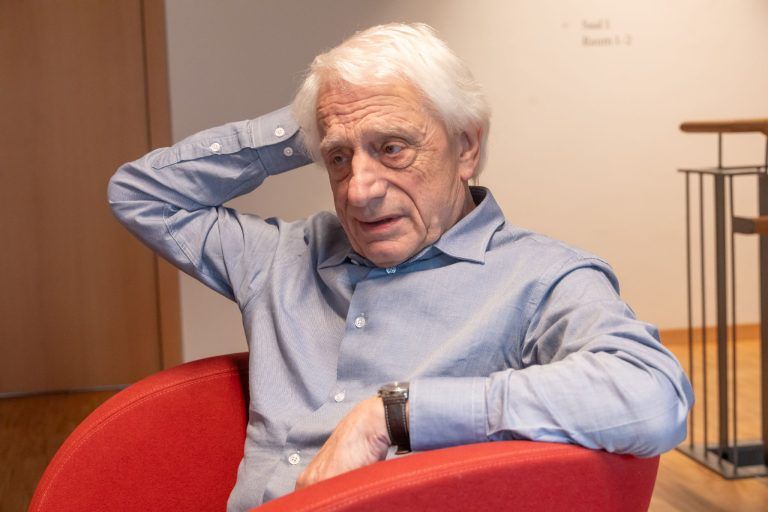
NEUE am Sonntag: Führung ist ein Begriff, der sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft vielseitig aufgeladen ist. Wie viel Führung braucht, verträgt oder wünscht sich der Mensch? Und wie lässt sich die offensichtliche Sehnsucht nach Führerfiguren, die gerade jetzt wieder einen Aufschwung erlebt, erklären?
Längle: Heute benötigen die Menschen anscheinend mehr Führung als noch vor 20 Jahren. Die Welt ist komplexer geworden, unüberschaubarer, noch etwas unsicherer – und auch überreguliert. Diese starken Figuren vermitteln ein ganz einfaches Programm in Schwarz und Weiß. Sie versprechen scheinbar unkomplizierte Lösungen, wie etwa „zurück zur guten alten Zeit“, in der es nur zwei Geschlechter gab und alles viel einfacher war. Aufhören mit Differenzierungen, die alles komplizierter machen, aber eigentlich eine Kultur vermitteln. Die Simplifizierung bedeutet Entlastung. Diese sogenannten „Volkstribunen“ versprechen Abschaffung fremdgesteuerter, überbordender Diktatur durch falsche Ideologien. Das war vielleicht ein Fehler der herkömmlichen Politik, dass die Eigeninitiative einfach zu wenig betont wurde. Man wurde zum Opfer des Kapitalismus und der Unterdrückung gemacht. Und die Gegenbewegung sagt, wir sind keine Opfer der Umstände, wir bestimmen die Situation und das ist ein Befreiungsakt. Menschen möchten frei sein, einen Überblick haben und Dinge verstehen. Genau das sind die Versprechen populistischer Führer. Dieser Verlust der Differenzierung verabschiedet sich von lang erfochtenen Werten – die Welt ist viel mehr als nur schwarz-weiß.
NEUE am Sonntag: Wie gehen Sie dann mit der auch daraus resultierenden Salonfähigkeit der Lüge, gerade auch in höchsten politischen Kreisen, um?
Längle: Es herrscht eine zunehmende Amoralität vor in der Politik, weil alles dem Ziel untergeordnet ist, einfache volksfängerische Parolen, Lösungen und Perspektiven aufzuzeigen. Und hier bedient man sich inzwischen offenkundig der Lüge, um sie am nächsten Tag abzutun, als ob nichts gewesen wäre. Dieser Kulturverfall in der Politik bereitet mir Sorgen. Diese Charakterlosigkeit, dass die Politiker nicht mehr zu ihrem Wort stehen. Was kann man noch glauben, in Zeiten von Fake-News und Falschinformation? Ein Grund mehr, den direkten persönlichen Kontakt, das Treffen von Person zu Person, wo man sich in die Augen schaut, zu suchen. Da sehe ich, da spüre ich, da rieche ich, da kann ich greifen – vielleicht eine Chance für die Renaissance einer Kultur der Begegnung und des unmittelbaren Dialogs.
NEUE am Sonntag: Der Mensch steht immer im Dialog mit der Außenwelt. In Zeiten von überbordendem Informationsfluss und dem Smartphone als ständigem Begleiter – kann uns die Existenzanalyse helfen, wieder auf uns selbst zu hören?
Längle: Die Logotherapie schaut darauf, dass man darauf achtet, was in diesem Moment als sinnvoll angesehen und was als nicht sinnvoll erlebt wird und man daher weglassen sollte. Gerade das Smartphone und insbesondere Social-Media sind ein wundervolles Werkzeug, bergen aber auch unendlich viele Möglichkeiten für sinnbefreite Ablenkung. TikTok oder so – wenn ich es nicht als sinnvoll erlebe, dann ist es das nicht. In der Existenzanalyse würden wir sagen: Die Beziehung zu sich selbst ist grundlegend. Ich sollte im Bewusstsein leben, dass ich mit mir durchs Leben gehe. Und wenn ich in Schwierigkeiten komme oder unter Druck, ist es das Wichtigste, mich nicht im Stich zu lassen, bei mir zu bleiben, mich nicht von mir abbringen zu lassen, mich nicht verfälschen zu müssen. Und wenn wir nun diesen Ablenkungsmustern ausgeliefert sind, würde ich entgegnen: Schau mal auf dich, was gewinnst du? Bist du näher bei dir selbst? Bist du erfüllter? Hast du ein besseres Leben? Bist du schöner? Wie siehst du dich selbst? Dass du dich richtig einem Automatismus überlässt, der dich dann von dir wegführt und entfremdet. Da würden wir in der Existenzanalyse ansetzen: Auf der Beziehung zu sich selbst als einem kostbaren Gut aufbauend eine stimmige Entscheidung treffen.
NEUE am Sonntag: Besteht dann aber nicht gerade für Jugendliche, die sich inmitten der Selbstfindung befinden, die Gefahr, durch diese allgegenwärtigen Ablenkungen, diese so wichtigen Prozesse für die Persönlichkeitsentfaltung nicht wirklich durchleben zu können?
Längle: Da sind die Eltern gefordert. Dass die Eltern mit ihren Kindern und Jugendlichen sprechen, dass sie sich austauschen, dass sie ihre Meinung sagen, ihre Sicht mitteilen. Dass man das Gespräch sucht, um herauszufinden, was den Jugendlichen fehlt, was sie glücklich macht. Dass man ihnen zuhört und das Feld nicht dem Smartphone überlässt. Jetzt haben wir es mit Social-Media oder dem Internet zu tun. Vor 20 Jahren bestand die Versuchung vielleicht mehr im Konsum von Drogen, auch heute noch, damals mit mehr Präsenz. Ein Kind von mir sagte einmal zu mir: „Also ich fange jetzt an zu haschen.“ Dann habe ich mit ihm eine Stunde geredet, und dann hat es ein-, zweimal probiert, aber das Gespräch hat irgendwie nachgehallt. Jahre später hat das inzwischen erwachsen gewordene Kind dann zu mir gesagt: „Nach dem Gespräch habe ich dann das Gefühl gehabt, das ist doch nicht so gut.“ Mehr können wir nicht machen. Sie müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, und wir können sie nur begleiten und animieren. Wenn sie es tun, wenn sie es nicht tun – es liegt nicht alles nur an uns. Aber ein großer Teil sehr wohl.
NEUE am Sonntag: Kommen wir wieder zurück zu Ihrem Vortragsthema. Wie unterscheiden sich Begriffe wie „Sinn“, „Purpose“ oder „Leidenschaft“ aus existenzanalytischer Sicht?
Längle: „Purpose“ bedeutet Zweck, nicht Sinn im existenziellen Sinn. In der amerikanischen Kultur ist vieles zweckorientiert. Doch Sinn ist etwas Tieferes, das auf innerer Zustimmung beruht.
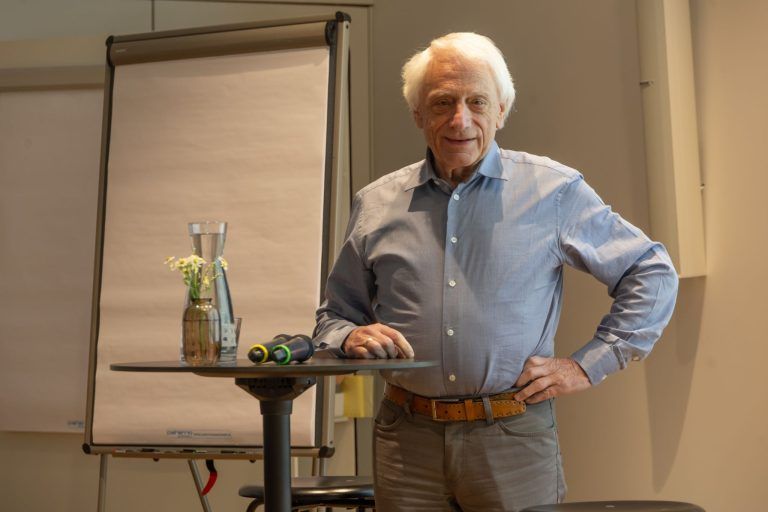
NEUE am Sonntag: Wie kann die Existenzanalyse gegen Burnout helfen?
Längle: Durch Achtsamkeit auf die eigene innere Stimmigkeit. Wer dauerhaft Dinge tut, denen er innerlich nicht zustimmt, erschöpft sich. Aber wer mit Zustimmung handelt, bleibt lebendig. Das ist der beste Schutz gegen Burnout.
NEUE am Sonntag: Was wünschen Sie sich persönlich für eine wünschenswerte Zukunft der Arbeitswelt?
Längle: Eine Kultur des Dialogs. Mehr Menschlichkeit. Dass Arbeit nicht bloß Mittel zum Zweck ist, sondern auch Raum für Entwicklung, für Sinn, für Zugehörigkeit bietet. Wenn Menschen mitreden dürfen, wenn sie gehört und gesehen werden, dann entsteht echte Motivation – und vielleicht sogar so etwas wie berufliches Glück.
Zur Person
Alfried Längle (74) ist Psychotherapeut, klinischer Psychologe sowie Arzt für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin. Der gebürtige Götzner lehrt an der Wirtschaftshochschule Moskau, als Gastprofessor an der Sigmund-Freud-Universität in Wien sowie an der Universität St. Gallen. Längle zählt zu den Gründungsmitgliedern der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse.
(NEUE am Sonntag)