“Im Bezug auf die KI stecken wir noch in den Kinderschuhen”

Primararzt Alexander De Vries und Lukas Mersich, Leiter der IT der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, über die KI im Spital in Feldkirch und den Fachkräftemangel.
Die künstliche Intelligenz (KI) ist längst in unserem Alltag angekommen. Egal, ob automatisierte Prozesse an der Kasse im Supermarkt, oder bei der Selbststeuerung von Autos. Aber auch in den Vorarlberger Spitälern hält die künstliche Intelligenz seit nunmehr drei Jahren Einzug.
Überall KI drin
Viele Menschen stellen sich, wenn es um KI geht, einen Roboter, oder ein völlig menschenleeres Gebäude vor. Dass das definitiv nicht der Fall ist, bestätigen Primararzt Alexander De Vries und Lukas Mersich, Leiter der IT der Vorarlberger Landeskrankenhäuser. „Wir setzen überall KI ein. Jedes Handy, jedes Suchprogramm, überall ist KI drin. Wir verwenden sie natürlich auch in den Vorarlberger Spitälern. Darum kommt man gar nicht mehr herum. Ich glaube, wir haben das Tool jahrelang eingesetzt, ohne es zu wissen.“ Tatsächlich kommt die künstliche Intelligenz aber mehr in der Verwaltung und zur Erleichterung in der Logistik zum Einsatz. Im medizinischen Bereich gibt es erst wenige Anwendungsgebiete.

Strahlentherapie
Der größte Einsatzbereich in der Medizin ist die Strahlentherapie. Die Risikoorgane und die Tumoren müssen vor der jeweiligen Therapie eingezeichnet werden. So kann genau festgelegt werden, was geschont und was bestrahlt wird. Bisher wurde dieser Vorgang von Menschen vorgenommen und dauerte in der Regel eine Stunde. Mittlerweile erledigt diesen Prozess ein Programm. „Dadurch hat der Mensch weniger Arbeitsaufwand. Das Einzeichnen durch die KI dauert lediglich 30 Minuten und erspart so bei jedem Patienten viel Zeit“, erklärt De Vries.

Neue Innovation
Die aktuellste Errungenschaft in Sachen künstliche Intelligenz ist erst seit vergangener Woche im „Livebetrieb“ im Spital in Feldkirch. Es handelt sich um die „digitale Pathologie“. Dabei werden Gewebezellen in mehreren Schichten von einem Roboter hauchdünn aufgeschnitten. Anschließend werden diese Gewebeplättchen, wie Lukas Mersich erklärt, von einem Hochleistungsmikroskop fotografiert und digital gespeichert. Dann komme die KI ins Spiel. Sie analysiert die einzelnen Plättchen der Gewebeentnahme und kann anhand des Bildmaterials feststellen, ob bösartiges Gewebe vorliegt. Eine Aufgabe, die von Menschen ausgeführt wesentlich länger dauern würde. „Es wird aber zu 100 Prozent alles noch einmal von einem Menschen gegengecheckt“, versichert Mersich. Auch im Bereich der Texterkennung (OCR) setzt das Krankenhaus auf die KI. Beispielsweise Rechnungen werden eingescannt und die OCR lernt, auf was sie zu achten hat und wo welche Daten stehen.
Eigentlich keine KI
Der sogenannte KI-Roboter „Da Vinci“, der letztes Jahr im Spital in Feldkirch im OP in den Einsatz genommen wurde, und als das KI-Vorzeigemodell in Vorarlberg schlechthin galt, fällt für die beiden Spezialisten eigentlich gar nicht in die Kategorie der künstlichen Intelligenz. „Das ist eigentlich alles der Mensch. Der Roboter handelt nicht alleine. Am Ende des Tages ist das nur ein verlängerter Arm des Mediziners. Mit künstlicher Intelligenz hat das eigentlich gar nichts zu tun“, erklärt der IT-Spezialist.
Was ist denn eigentlich KI?
Ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Systemen und Maschinen befasst, die menschenähnliche Intelligenz zeigen. Diese Intelligenz umfasst Fähigkeiten wie lernen und verstehen.
Immer vom Arzt geprüft
„KI hat natürlich auch viel mit Fachkräftemangel zu tun“, betont Mersich. Die Krankenhäuser müssen darauf achten, das menschliche Kapital so ressourcenschonend und effizient wie möglich einzusetzen- Mit Hilfe der KI, aber immer im Sinne der Menschen. „Was können wir im medizinischen Bereich abgeben, ohne dass es zu Einschränkungen in der Therapie kommt?“, resümiert De Vries. Auch der soziale Aspekt spiele hier eine entscheidende Rolle. „Die Alternative ist hier keine KI. Jeder Patient ist etwas Besonderes, Maschinen merken nicht, was da dahintersteckt“, so der Primararzt. „Der Mensch wird nie ersetzbar werden“, sind sie sich einig. Maschinen können weder die Emotionalität eines Erstgesprächs einordnen, noch die Sorgen und Ängste der Patienten bei Visiten abfangen. Essenzielle Faktoren, wenn es um den Umgang mit Patienten geht.
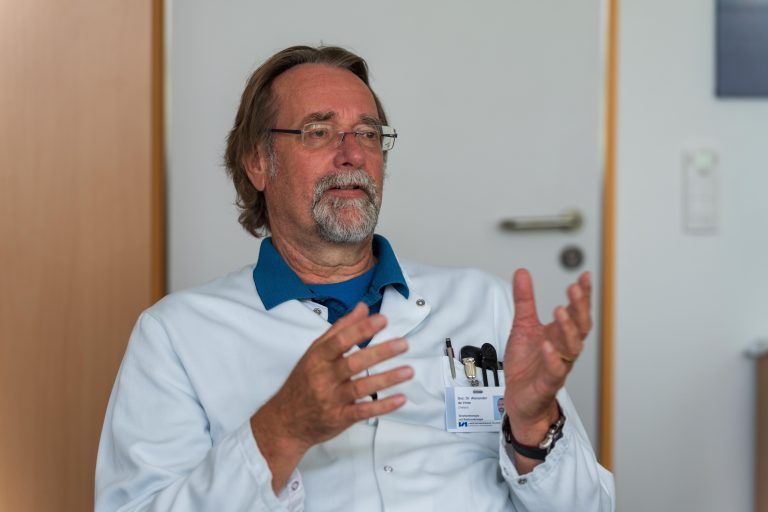
Eine schwierige Frage
Ob die Patienten darüber informiert werden sollen, dass sie unter anderem mit KI behandelt werden, ist eine schwierige Frage. „Das ist eine philosophische Diskussion. Die große Frage ist, wenn ich anfange, die Patienten über kontrollierte Errungenschaften aufzuklären, über welche Errungenschaften kläre ich sie nicht auf?“ Können Patienten überhaupt beurteilen, ob sie das wollen? Im Falle einer Ablehnung könnte dann keine Behandlung durchgeführt werden. Es sei aber mit Sicherheit eine ethische Frage für die Zukunft. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir selbst nicht anders behandelt werden wollen würden“, erklärt De Vries. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist bei uns nur KI im Einsatz, die uns als Werkzeug dient. Das bedeutet, dass alle Ergebnisse, die da herauskommen, zu 100 Prozent von einem Arzt gegengeprüft werden“, so Mersich.
Ab dem Zeitpunkt, zu dem Behandlungen rein maschinell durchgeführt werden, müssen Patienten auf jeden Fall informiert werden. „Dann wird man Aufklären müssen und nach dem Einverständnis fragen, oder ob die Behandlung lieber von einem Menschen durchgeführt werden soll“, so De Vries. Im Landeskrankenhaus findet derzeit noch keine rein maschinell gefällte Entscheidung statt.
Wer trägt Verantwortung?
Aber auch was im Falle eines technischen Versagens passieren würde, beschäftigt das Team der Spezialisten des Landeskrankenhauses. Wer würde die Verantwortung für eine falsche Therapieentscheidung tragen? Derjenige, der die KI entwickelt hat, die Firma, die sie verkauft hat, oder der Arzt, der (nicht) kontolliert hat; wer ist zuständig? All diese Fragen sind konstante Begleiter des Teams rund um De Vries und Mersich. „Wir sind da etwas zurückhaltend und aufmerksam“, so der Primararzt.
Es gibt insgesamt vier Stufen der KI, das Landeskrankenhaus Feldkirch befindet sich momentan am Anfang der Stufe zwei. „Stufe vier der KI würde bedeuten, dass sie weiß, dass sie denkt. Die Maschine ist sich in diesem Moment bewusst, was sie tut. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Wir gehen noch in den Kinderschuhen“, sagt Mersich. Die Frage sei aber auch, ob man schlussendlich wolle, dass das so sei. „Momentan übernimmt die KI viel Arbeit bei uns. Das würde ich nicht als ‚im Hintergrund‘ bezeichnen. Es ist aber ein ganz bewusster Umgang damit.“

Auftrag an das Land
„Ich bin ganz klar der Meinung, das Land muss eine Abteilung für KI schaffen, die uns hilft. Die IT bei uns im Haus kann nicht anfangen, ohne personelle Ressourcen, KI’s zu überprüfen. Es wird eine Stelle benötigen, die Entscheidungen trifft und auch zu unserem Schutz da ist“, so De Vries. Er würde sich keine Verkaufsstelle wünschen, sondern eine Fachabteilung, die künstliche Hilfsmittel anpasst und an das Haus verkauft. „Wie beispielsweise eine Dienstplan-KI“, schmunzelt der Primararzt.