Mit Lenin auf dem Philosophenschiff
![ABD0076_20211018 – FRANKFURT/M. – DEUTSCHLAND: 18.10.2021, Hessen, Frankfurt/M.: Monika Helfer, Autorin des Buches “Vati”, steht mit ihrem Ehemann, dem Autoren Michael Khlmeier, vor dem Rmer. Helfer steht auf der Shortlist fr den Deutschen Buchpreis. Mit dem Deutschen Buchpreis wird der beste deutschsprachige Roman ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert. Der Preistrger […]](/2024/08/ABD0076-20211018-1-768x511.jpg)
In „Das Philosophenschiff“ verbindet Michael Köhlmeier Weltgeschichte mit fiktiven Erinnerungen. Nun steht der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
Im Jahr 1922 ist Anouk Perleman-Jacob vierzehn Jahre alt, als sie zusammen mit ihren Eltern und einer Handvoll anderer Intellektueller auf ein Schiff verfrachtet wird. Als Hundertjährige sitzt sie nun in ihrer Villa in Hietzing und erzählt einem Schriftsteller von den möglicherweise prägendsten Erinnerungen ihres Lebens.
Episoden einer Kindheit
„Es ist schön, eine verlorene Zeit wiedererstehen zu lassen, und dann verliere ich mich in ihr. Sogar, wenn sie schrecklich war“, sagt die Architektin, später wird Köhlmeiers Protagonist – ebenfalls ein Schriftsteller – ihre Erzählungen auf die Richtigkeit nachprüfen. Über mehrere Tage und Wochen treffen sich die zwei Figuren und graben in der Vergangenheit. Die eine will kurz vor ihrem Tod Episoden ihrer „wahren“ Lebensgeschichte weitergeben. Der andere versucht, das Gehörte mit dem historischen Kontext in Verbindung zu bringen, im Auftrag der Architektin ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben.
In „Das Philosophenschiff“ hat Michael Köhlmeier eine erfundene Familiengeschichte mit historischen Fakten und realen Personen verknüpft und setzt seine Protagonisten in Rückblicken in ein Russland, das vom Bürgerkrieg und der russischen Revolution geformt wird. Anouks Eltern sind befreundet mit Dichtern, Intellektuellen und Terroristen. Es geht um Mordanschläge, Attentaten, Rachefeldzüge, Verdächtigungen, Inszenierungen, die Emigration ins Exil und das alles wird aus der Perspektive einer scheinbar völlig unbeteiligten Familie geschildert, die sich schließlich auf einem bewegungslos im Wasser stehenden Luxusdampfer mit zehn weiteren unfreiwilligen Passagieren mitten im Meer wiederfindet, wo sich Anouk ungesehen ans Deck des Schiffes begibt und den im Rollstuhl sitzenden Lenin entdeckt.
Detailliert beschreibt Anouk die Atmosphäre auf dem Schiff, berichtet von den Jahren ihrer Kindheit in Russland und thematisiert die politischen Hintergründe, die zur von Lenin beauftragen Aktion, die geistige Elite ins Ausland abzuschieben, geführt haben. Vor allem aber erinnert sie sich an ihre Gefühle rund um das Leben und Überleben ihrer dreiköpfigen Familie.
Anouk bricht ihre Erzählungen oft mittendrin ab, wechselt das Thema und reiht etwa Anekdoten über berühmte Persönlichkeiten neben ihre schwierige emotionale Bindung zu ihrem Vater. Die Geschichte ist nicht chronologisch, sondern springt oft Jahre voraus oder zurück und beleuchtet jeweils nur einzelne Erlebnisse.
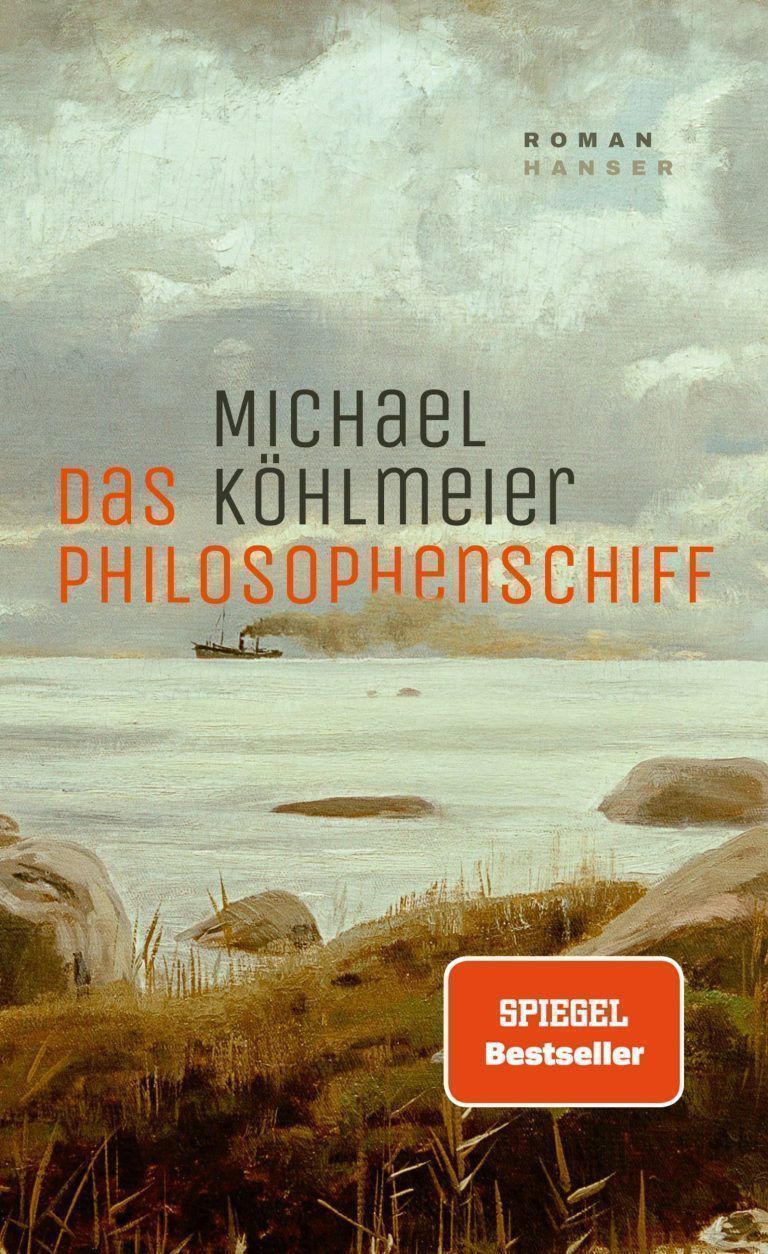
Köhlmeiers Roman ist gefüllt mit Lebensweisheiten, belegbaren, erfundenen und auch ganz alltäglichen Situationen, ironischen Formulierungen und der poetischen Geschichte über den politische Terror jener Zeit, der das Leben von Anouks Eltern in Angst und Unsicherheit stürzt, und die auch beschreibt, wie selbst Lyrik zu etwas Gefährlichem werden kann: „Als die Gedichte geschrieben worden waren, dachte niemand in Russland an eine Revolution, also auch nicht an eine Konterrevolution. Etwas Unverdächtigeres zu schreiben, wäre eine Meisterleistung gewesen“, es müsse sich natürlich um ein Versehen handeln, wenn friedliche Menschen aus der Heimat verbannt werden, denken zumindest die Eltern. Warum sie selbst und ebenjene so unscheinbar wirkenden Mitreisenden auf der Abschiebeliste gelandet sind, wird in Vermutungen beleuchtet.
Als Erzählerin ist Anouk nicht zuverlässig, lässt Lücken, reduziert Begebenheiten auf unfertige Details und da sie zu einem großen Teil als Tochter vom Leben der Eltern spricht, sind manche Geschichten eher vage oder wurden auch erst später aus Unwissenheit „zusammenrecherchiert“. Manches Erzählte ist auch absichtlich gelogen, wie der Schriftsteller auf Nachfrage feststellt. „Ich habe das erfunden. Aber nicht, um Sie zu täuschen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Wahrheit ein bisschen von mir weg erfinden wollen. Können Sie das verstehen?“
Zwischen dem Monolog der Hundertjährigen gibt es Pausen, der Erzählstrom bricht ab und Köhlmeier bringt seine Leser zurück nach Wien ins Jahr 2008, wo er das Treiben seiner Schriftstellerfigur und begleitet, die ebenfalls Michael heißt, in Vorarlberg beheimatet ist und abends mit seiner Frau Monika telefoniert.
Michael Köhlmeier: „Das Philosophenschiff“, 224 Seiten, 24,70 Euro, Erschienen am 29. Jänner im Hanser Verlag, nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024.