Von der „Alpenfestung“ zur „Festung Vorarlberg“

Neueste Beiträge zum Kriegsende in Vorarlberg und den Erzählungen darüber liefert ein Buch, das am kommenden Donnerstag, den 25. September in Feldkirch vorgestellt wird: „Schelling revisited“.
Von Kurt Bereuter
neue-redaktion@neue.at
Das Diözesanarchiv Feldkirch, unter der Leitung von Michael Fliri, verfügt seit 2019 über Grundlagendokumente zu einem Standardwerk zum Kriegsende in Vorarlberg: Georg Schellings „Festung Vorarlberg“. Anhand dieser Dokumente geht das Archiv in seinem 14. Band dem Kriegsende vor 80 Jahren, und damit dem „Übergang vom Krieg zum Frieden in Vorarlberg 1945“, noch einmal nach und liefert neue Erkenntnisse und unterzieht Schellings Werk einer neuerlichen Einordnung.
Alpenfestung
Schon Ende 1944 gab es glaubhafte Gerüchte auf US-amerikanischer Seite, dass in Vorarlberg, so wie in anderen schwer zugänglichen Regionen in den Alpen Bayerns und Österreichs, eine „Alpenfestung“ gebaut werde. Also ein letzter sicherer Rückzugsort für die „Führung“ des Deutschen Reiches. Tatsächlich gab es die nie, weder in Vorarlberg noch in anderen Teilen der Alpen. Warum Georg Schelling den Titel „Festung Vorarlberg“ verwendete, erklärt Mitherausgeber Wolfgang Weber so: „Einerseits schloss Schelling damit an eine gut verbreitete NS-Terminologie an und andererseits war der Titel ein journalistischer Coup.“
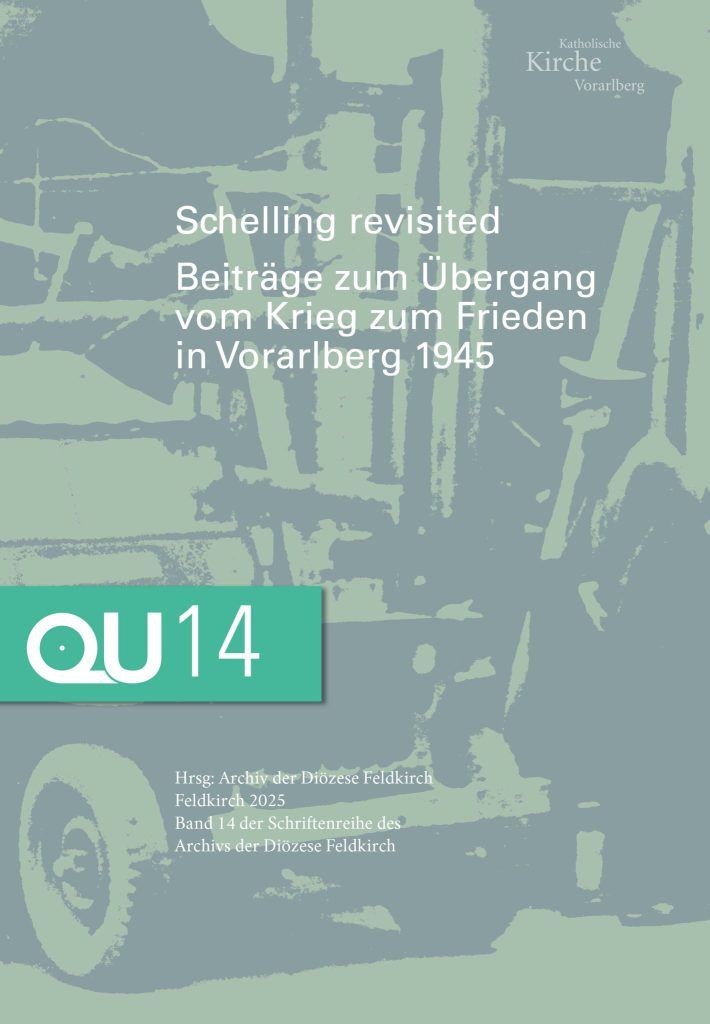
Ein Priester und Chefredakteur
Pfarrer Georg Schelling war Priester und Chefredakteur der christlichsozialen Vorarlberger Tageszeitung „Vorarlberger Volksblatt“ bis zu seiner Verhaftung, wenige Tage nach dem Anschluss an das Deutsche Reich im März 1938. Nach sieben Jahren Haft in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau wurde er drei Wochen vor Kriegsende enthaftet und Kaplan in Altach, wo er sich in mehreren Zeitungsbeiträgen im November und Dezember 1945 im Vorarlberger Volksblatt dem Kriegsende widmete. Schon 1947 legte er diese Beiträge als Buch unter dem Titel „Festung Vorarlberg“ vor. Es wurde noch zwei weitere Male, 1980 und 1987 aufgelegt. 1987 unter dem Malin-Historiker und Pädagogen Meinrad Pichler, und es entfaltete seine Wirkung als „Standardwerk“. Jetzt liegt ein weiteres Buch vor, das sich der Einordnung und Ergänzung von Schellings Beiträgen zum Kriegsende vor 80 Jahren in Vorarlberg annimmt.

„Das Buch ‚Festung Vorarlberg‘ wurde als ‚Tatsachenbericht‘ beworben und fand so seinen Weg in viele Vorarlberger Haushalte.“
Michael Fliri, Leiter Diözesanarchiv Feldkirch
Musealisierung von Erinnerung
Schellings Buch ist kein geschichtswissenschaftliches, aber eines, das ganz nah am Zeitgeschehen geschrieben wurde und dank mündlicher Quellen auch zu einem „Sprachrohr der mündlichen Überlieferung“ wurde. Schelling habe mit seinem Buch nicht nur eine Textquelle geschaffen, sondern ein gegenständliches Sachzeugnis, dessen Materialität für die „Musealisierung der Erinnerung“ ebenfalls eine wichtige Rolle spiel(t)e, erklärt der Historiker Daniel Marc Segesser. Seit 2019 sind nun Dokumente, die das Fundament des Buches bilden, immerhin fast 1700 Seiten, im Diözesanarchiv Feldkirch öffentlich zugänglich und werden durch diesen neuen Band des Archivs ans Licht geholt.
Das Beispiel Kleines Walsertal
Das Kleine Walsertal wurde von Kriegshandlungen bei der Befreiung Österreichs durch die französische Armee 1945 verschont. Zu verdanken haben sie es dem „Heimatschutz“, einer Widerstandsgruppe um den Metzgermeister Peter Meusburger. Sie standen in Kontakt zu den im „Hotel Ifen“ inhaftierten Prominenten und wurden von diesen auch beraten und unterstützt. Vor allem von André Francois-Poncet. Er war bis 1938 Französischer Botschafter im Deutschen Reich und eben im „Hotel Ifen“ im Kleinen Walsertal mit anderen Diplomaten interniert. Der „Heimatschutz“ im Kleinen Walsertal war laut Schelling schon 1943 aktiv. Laut ihm wurden Deserteure versteckt, Waffen gehortet und eben mit den inhaftierten prominenten Häftlingen im „Hotel Ifen“ Informationen ausgetauscht. Schelling habe hier dem Dorfchronisten Alfons Köberle, einem Freund Meusburgers, vertraut und den „Heimatschutz“ als „heldenhaft“ dargestellt. Demgegenüber halten die Historikerinnen Hannah Adam und Carla Balmer im neuen Band fest, dass im Tagebuch des Francois-Poncet der Diplomat den Heimatschutz praktisch nie erwähnte und er erst in seinem Eintrag vom 25. April 1945 von „methodischen Maßnahmen“ schrieb, „um das Tal als neutrales Gebiet erscheinen zu lassen“. Den Metzger Meusburger habe er aber als „seinen Freund“ und „Mann von perfekter Würde und Einfachheit“ beschrieben und die Machtübernahme des Heimatschutzes im Kleinen Walsertal als Revolution.

„Der Titel von Schelling nutzte die NS-Terminologie und war ein journalistischer Coup.“
Wolfgang Weber, Mitautor
Egg und Hutfabrik Sommer
Die neu entdeckten Dokumente aus dem Nachlass Schellings zur Befreiung der Gemeinde Egg eigneten sich geradezu idealtypisch dafür, zu zeigen, wie und warum Schelling welche Rollen an die ehemaligen Nationalsozialisten „vergab“. So sei es laut dem Historiker Daniel Marc Segesser dem Egger NS-Ortsgruppenleiter Ewald Sommer, der in Egg eine Hutfabrik betrieb und Zwangsarbeiter aus dem nahen Lager einsetzte, gelungen, die Zeitungsbeiträge von Schelling und ihn im Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens für sich zu nützen, um als „minderbelaster Nationalsozialist“ eingestuft zu werden. Georg Schelling trage damit einen Teil der Verantwortung dafür, dass es NS-Verantwortlichen in Vorarlberg, wie Sommer, gelang, ihr Narrativ über die Zeit zwischen 1938 und 1945 zu etablieren und sich zu entlasten.
Ein Versuch der Einordnung
Auch wenn der Band noch nicht gedruckt vorliegt, verspricht er doch eine kritische Sicht auf Schellings Werk der „Festung Vorarlberg“, die nach drei Ausgaben überfällig ist und zudem stellt sich die Frage, wie Schellings Werk in der historischen Forschung wirkte, aber auch in den Narrativen der Bevölkerung seine Funktion entfaltete. Dass seine eigene Biographie als Priester, ehemaliger KZ-Häftling und Chefredakteur einer christlichsozialen Tageszeitung Bedeutung hat, versteht sich von selbst. Thematisiert hatte er diese Rolle nicht. Wolfgang Weber erklärt, dass Schelling mit seinem programmatischen Beitrag „Die Nacht ist um!“ nicht nur eine „Stunde Null“ schaffen wollte, sondern zugleich Urheber des wirkungsmächtigen Narratives war, dass die NS-Diktatur ein Produkt „volks- und landfremder Säbelrassler“ war, die mit der Befreiung durch die Französische Armee abrupt geendet habe – nicht ohne Unterstützung von patriotischen Einheimischen, wie Schelling schrieb. Dass die NSDAP eine starke lokale Verankerung hatte, ist mittlerweile umfangreich publiziert. Dass sich „Ehemalige“ an den Priester, Redakteur und ehemaligen KZ-Häftling Schelling wandten, um ihren Persilschein zu erhalten, erklärte Schelling selbst: „Die Nationalsozialisten haben sieben Jahre das Volk drangsaliert, jetzt war es gerade ihre Aufgabe, noch in letzter Minute die Katastrophe aufzuhalten. Weil manche von ihnen diese Einsicht gehabt haben, wollen wir sie doch nicht mit Steinen bewerfen, auch dann nicht, wenn im Einzelfall der Beweggrund der Handlung die Sicherung der persönlichen Zukunft gewesen sein sollte.“
Buchpräsentation
„Schelling revisited. Beiträge zum Übergang vom Krieg zum Frieden in Vorarlberg 1945.“ Ein Autorenteam widmet sich an diesem Abend den Geschehnissen in Egg, im Kleinen Walsertal und in Feldkirch.
Termin: 25. September, 19 Uhr
Ort: Palais Liechtenstein,Feldkirch